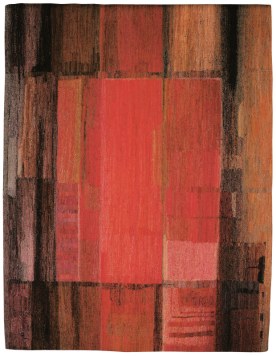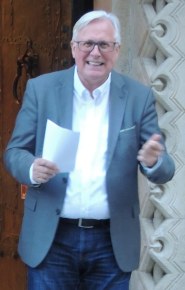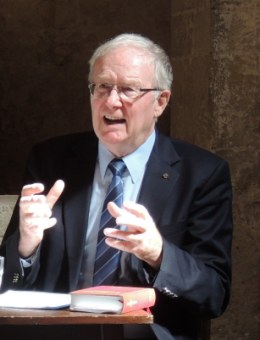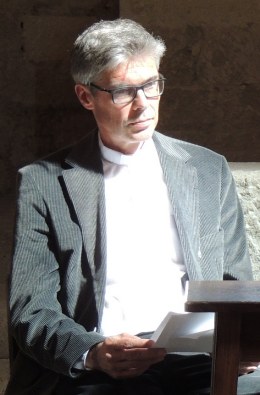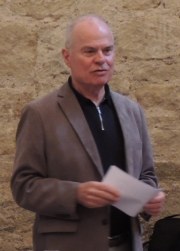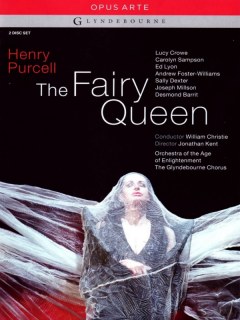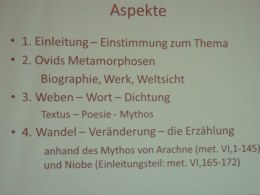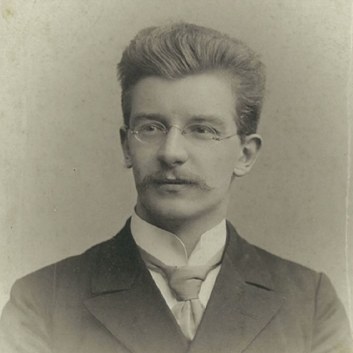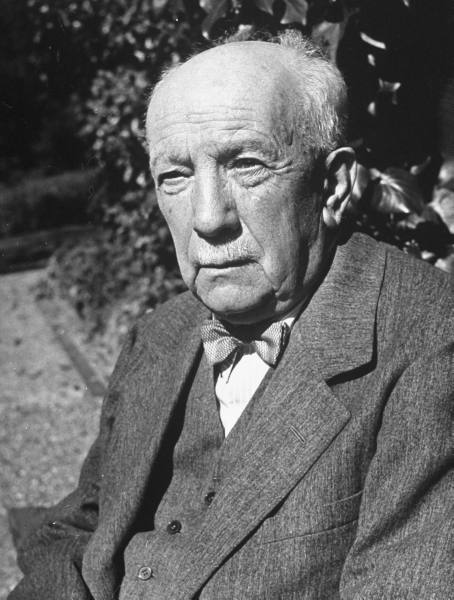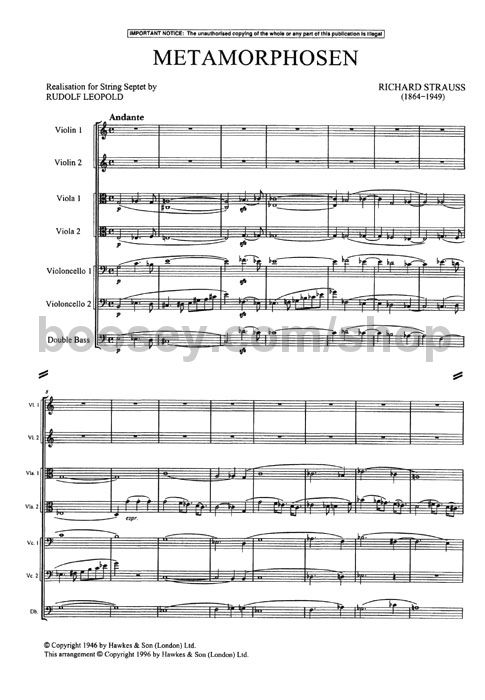Übersicht alle
bisherigen Ausstellungen |
KIK Fotos und Berichte
|
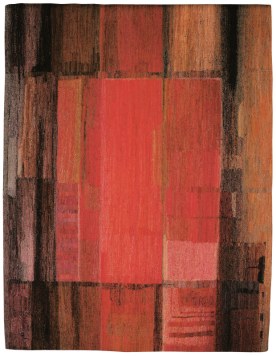
|
Donnerstag,
7. September 2017

Doris Reiser
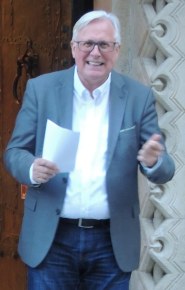
Carl Aigner

Karner

im Karner |
Vernissage
Frank Lechner
Bildteppiche - Metamorphose / Wandlung
Begrüßung:
Doris
Reiser, Einführung:
Carl Aigner |
|
 Nach
einer musikalischen Einstimmung durch den Mödlinger Musiker Markus Pagitsch begrüßt Organisatorin Doris Reiser die zahlreich erschienenen
Gäste am Kirchenplatz und bedankt sich bei der Künstlerin Franka
Lechner für ihr Kommen. Angeregt durch den Titel des gezeigten
Hauptwerkes „Metamorphose Rot“ steht das Rahmenprogramm der
diesjährigen Ausstellung unter dem Motto der „Wandlung“. Nach der
Vorstellung der einzelnen Programmpunkte, die dieses Jahr erstmalig
konzentriert an einem Wochenende stattfinden, begrüßt Doris Reiser
Carl Aigner, künstlerischen Leiter des Museums Niederösterreich, der
bereits mehrere Ausstellungen im Karner eröffnet hat. Als profunder
Kenner der zeitgenössischen Kunstszene ist er besonders erfreut, dass
hier für die jahrzehntelang eher stiefmütterlich behandelte Nach
einer musikalischen Einstimmung durch den Mödlinger Musiker Markus Pagitsch begrüßt Organisatorin Doris Reiser die zahlreich erschienenen
Gäste am Kirchenplatz und bedankt sich bei der Künstlerin Franka
Lechner für ihr Kommen. Angeregt durch den Titel des gezeigten
Hauptwerkes „Metamorphose Rot“ steht das Rahmenprogramm der
diesjährigen Ausstellung unter dem Motto der „Wandlung“. Nach der
Vorstellung der einzelnen Programmpunkte, die dieses Jahr erstmalig
konzentriert an einem Wochenende stattfinden, begrüßt Doris Reiser
Carl Aigner, künstlerischen Leiter des Museums Niederösterreich, der
bereits mehrere Ausstellungen im Karner eröffnet hat. Als profunder
Kenner der zeitgenössischen Kunstszene ist er besonders erfreut, dass
hier für die jahrzehntelang eher stiefmütterlich behandelte
 Kunst des
Bildwirkens, die Tapisseriekunst, ein Forum geboten wird. Aigner
betont, dass Franka Lechner unbeirrt von den unterschiedlichen
Kunstströmungen seit ihrem Studium bei Pauser und Böckl der Webkunst
treu geblieben ist. Er leitet seinen Vortrag ein mit einem Gedicht von Franka Lechner, das
die Farben mit den Klängen der Musik vergleicht und erinnert an Paul
Klee, der viele Jahre lang die Textilklasse am Bauhaus geleitet hat:
seine Malerei ist stark beeinflusst von den Eindrücken, die er auf
seiner legendären Tunisreise gesammelt hat, wobei die Strukturen
seiner späteren Bilder stark an die Webteppiche tunesischer Frauen
erinnern. Dieser starke Zusammenhang von Malerei und Webkunst ist auch
in Franka Lechners Ouevre erkennbar, wiewohl ihre collagenartigen
Bilder nicht als Entwürfe für die farbintensiven Bildteppiche zu
verstehen sind. Ein Zitat von Paul Klee bildet den Abschluss seiner
Gedanken zu Franka Lechners abstrakten, aber trotzdem inhaltlich
reichen Bildteppichen: „Kunst gibt nicht das Sichtbare wider, sondern
macht sichtbar.“ Kunst des
Bildwirkens, die Tapisseriekunst, ein Forum geboten wird. Aigner
betont, dass Franka Lechner unbeirrt von den unterschiedlichen
Kunstströmungen seit ihrem Studium bei Pauser und Böckl der Webkunst
treu geblieben ist. Er leitet seinen Vortrag ein mit einem Gedicht von Franka Lechner, das
die Farben mit den Klängen der Musik vergleicht und erinnert an Paul
Klee, der viele Jahre lang die Textilklasse am Bauhaus geleitet hat:
seine Malerei ist stark beeinflusst von den Eindrücken, die er auf
seiner legendären Tunisreise gesammelt hat, wobei die Strukturen
seiner späteren Bilder stark an die Webteppiche tunesischer Frauen
erinnern. Dieser starke Zusammenhang von Malerei und Webkunst ist auch
in Franka Lechners Ouevre erkennbar, wiewohl ihre collagenartigen
Bilder nicht als Entwürfe für die farbintensiven Bildteppiche zu
verstehen sind. Ein Zitat von Paul Klee bildet den Abschluss seiner
Gedanken zu Franka Lechners abstrakten, aber trotzdem inhaltlich
reichen Bildteppichen: „Kunst gibt nicht das Sichtbare wider, sondern
macht sichtbar.“
Nach der Eröffnungsansprache von Bürgermeister LAbg. Hans Stefan
Hintner, der überzeugt ist, dass die ausgestellten Kunstwerke jeden
Betrachter berühren und erfüllen werden, zeigt Markus Pagitsch mit
seiner Version von „Amazing grace“, dass er nicht nur wunderbar
improvisieren kann. In der inzwischen hereingebrochenen Dämmerung
leuchten die warmen Rottöne von Franka Lechners gewebten Kunstwerken
noch intensiver und einladender vom Karner auf den Kirchenplatz.
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| nach
oben |
Text: dr, Fotos: gm |
|
Samstag,
9. September 2017
10:00


Franka Lechner |
Gespräch mit der
Künstlerin
Franka Lechner
Vom Faden zum Bild – Textile Kunst im Wandel der Zeit |
 Das
Gespräch zwischen der Künstlerin Franka Lechner und
Ausstellungsorganisatorin Doris Reiser versuchte zuerst die Frage zu
beantworten, wie man denn eigentlich Künstlerin wird: Franka Lechner
wusste schon als kleines Kind, dass sie Malerin und ihre 2 Jahre
ältere Schwester Schriftstellerin werden würden. Mit 15 wurden
erstmalig Bilder von ihr in einer Ausstellung in Paris gezeigt. Auch
das Studium an der Akademie der bildenden Künste in Wien schien
selbstverständlich und passte in ihren Lebensentwurf. Durch die frühe
Heirat und Mutterschaft wurde diese Entwicklung jäh abgebremst. Eine
Hinwendung zur Webkunst wurde erst ca 10 Jahre später immer spürbarer
und stellt seitdem das Hauptarbeitsgebiet der Künstlerin dar. Sie
erlebt noch die letzten bedeutenden Jahre der Textilkunst in
Österreich mit, lässt sich aber auch in den darauf folgenden Jahren
des abflauenden Interesses für Tapisserien nicht beirren und so
entsteht bis heute ein riesiges Konvolut an gewirkten Bildern aus
selbst gefärbter Wolle in leuchtenden Farben
und reichen Abstufungen. Fast gleichzeitig wird sie als Lyrikerin von
Hans Weigel entdeckt und beide Kunstformen dienen ihr als
Ausdrucksmittel für ihre inneren Bilder. Die Vergleichbarkeit des
Bildwirkens mit musikalischen Elementen wie Rhythmus oder Klang sind
für Franka Lechner wichtige Aspekte ihres Schaffens und bilden
zusammen mit dem Faktor Zeit, der durch das langsame Fortschreiten der
Arbeit am Webstuhl in fast meditativer Form in die Kunstwerke
einfließt, eine Hauptaussage in ihrem Werk. Das
Gespräch zwischen der Künstlerin Franka Lechner und
Ausstellungsorganisatorin Doris Reiser versuchte zuerst die Frage zu
beantworten, wie man denn eigentlich Künstlerin wird: Franka Lechner
wusste schon als kleines Kind, dass sie Malerin und ihre 2 Jahre
ältere Schwester Schriftstellerin werden würden. Mit 15 wurden
erstmalig Bilder von ihr in einer Ausstellung in Paris gezeigt. Auch
das Studium an der Akademie der bildenden Künste in Wien schien
selbstverständlich und passte in ihren Lebensentwurf. Durch die frühe
Heirat und Mutterschaft wurde diese Entwicklung jäh abgebremst. Eine
Hinwendung zur Webkunst wurde erst ca 10 Jahre später immer spürbarer
und stellt seitdem das Hauptarbeitsgebiet der Künstlerin dar. Sie
erlebt noch die letzten bedeutenden Jahre der Textilkunst in
Österreich mit, lässt sich aber auch in den darauf folgenden Jahren
des abflauenden Interesses für Tapisserien nicht beirren und so
entsteht bis heute ein riesiges Konvolut an gewirkten Bildern aus
selbst gefärbter Wolle in leuchtenden Farben
und reichen Abstufungen. Fast gleichzeitig wird sie als Lyrikerin von
Hans Weigel entdeckt und beide Kunstformen dienen ihr als
Ausdrucksmittel für ihre inneren Bilder. Die Vergleichbarkeit des
Bildwirkens mit musikalischen Elementen wie Rhythmus oder Klang sind
für Franka Lechner wichtige Aspekte ihres Schaffens und bilden
zusammen mit dem Faktor Zeit, der durch das langsame Fortschreiten der
Arbeit am Webstuhl in fast meditativer Form in die Kunstwerke
einfließt, eine Hauptaussage in ihrem Werk. |
|
 |
 |
|
 |
 |
| nach
oben |
Text: dr, Fotos: gm |
|
Samstag,
9. September 2017
12:00

Franka Lechner |
| Lesung (Lyrik und Prosa) mit
Franka Lechner |
|
Nach einer
kurzen Pause liest die Künstlerin aus ihrem lyrischen Werk, wobei sie
die meist kurzen Gedichte nach inhaltlichen Gruppen ordnet. Es fällt
auf, dass manche der Gedichte die gleichen Bezeichnungen tragen wie
die Bildteppiche, die gleichzeitig entstanden sind. Das zeigt die
tiefe Auseinandersetzung Franka Lechners mit den unterschiedlichsten
Einflüssen in allen künstlerischen Formensprachen. Besonders berührend
sind dabei die Sprachbilder, die mit Farb- und Klangvorstellungen
arbeiten |
 |
| nach
oben |
Text & Fotos: dr |
|
Samstag,
9. September 2017
14:00

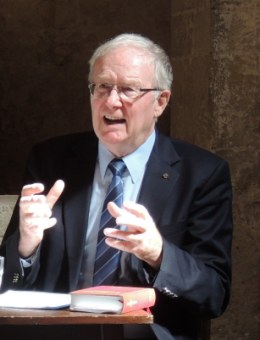
Altpfarrer Klaus Heine
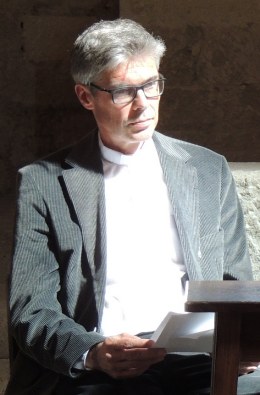
Pfarrer Richard Posch
 |
"Zugrundegehn und
auferstehn"
Die Wandlung in der Eucharistie und Metamorphose in der christlichen
Jenseitshoffnung. Ein theologisches Gespräch mit den Pfarrern
Richard Posch
und Klaus Heine |
 Im
theologischen Gespräch zwischen Klaus Heine und Richard Posch betonte
Heine zunächst, dass es bei Metamorphosen nicht um die ständige
Veränderung im Leben, sondern um den besonderen Einschnitt und
Gestaltwandel gehe. So bedeutet die gläubige Begegnung mit dem
Christusereignis eine so fundamentale Veränderung, dass sie mit einer
neuen Geburt vergleichbar wird. Er erläuterte dies mit einer Auslegung
des nächtlichen Gesprächs Jesu mit Nikodemus im JohEv Kap.3. Ganz
ähnlich deutet Paulus im Römerbrief Kap.6 die Taufe als ein Mitsterben
und Auferstehen mit Christus. Der Apostel zieht auch die ethischen
Folgerungen daraus, wenn er im Römerbrief Kap.12 die Gläubigen dazu
auffordert, die Metamorphose durch den Glauben an Christus durch das
Tun und Verhalten im alltäglichen Leben zu erweisen. Im
theologischen Gespräch zwischen Klaus Heine und Richard Posch betonte
Heine zunächst, dass es bei Metamorphosen nicht um die ständige
Veränderung im Leben, sondern um den besonderen Einschnitt und
Gestaltwandel gehe. So bedeutet die gläubige Begegnung mit dem
Christusereignis eine so fundamentale Veränderung, dass sie mit einer
neuen Geburt vergleichbar wird. Er erläuterte dies mit einer Auslegung
des nächtlichen Gesprächs Jesu mit Nikodemus im JohEv Kap.3. Ganz
ähnlich deutet Paulus im Römerbrief Kap.6 die Taufe als ein Mitsterben
und Auferstehen mit Christus. Der Apostel zieht auch die ethischen
Folgerungen daraus, wenn er im Römerbrief Kap.12 die Gläubigen dazu
auffordert, die Metamorphose durch den Glauben an Christus durch das
Tun und Verhalten im alltäglichen Leben zu erweisen. |
Posch schloss in seinen
Überlegungen zur Wandlung der Elemente Brot und Wein beim Herrenmahl
an diese Gedanken an, indem er die Christusbezogenheit der
Sakramentsfeier nachhaltig unterstrich. Christi schöpferisches
Vermächtnis durch seine Lebenshingabe und seine Auferstehung zu einem
neuen Leben stehen im Mittelpunkt bei dieser Identifizierung mit den
Elementen Brot und Wein. Das Wort der Gnade wird sinnlich erfahrbar.
Posch belegte das mit einer Fülle an Zitaten aus den Kirchenvätern und
kritisierte die zunehmende Fixierung auf die Elemente im Mittelalter.
Im reformatorischen Protest erkannte er durchaus berechtigte
Korrekturen im Rückgriff auf Augustin. Dankbar stellte er auch die
heutige weitgehende Einigung im Verständnis der Realpräsenz Christi in
der Eucharistiefeier zwischen den Konfessionen fest.
 |
| Heine nahm in seinen
Schlussgedanken die Frage des Paulus im Korintherbrief Kap.15 auf, mit
welchem Leib denn die Toten am Jüngsten Tage auferstehen werden. Hier
vollendet sich die Metamorphose, die im Glauben an das
Christusereignis grundgelegt wird. Dieser Leib ist totaliter aliter
als der in der Todeswelt. Es geht aber auch nicht um eine Auflösung in
einen göttlichen Energiestrom. Es ist ein Leib eigener Art, der in
ungestörtem ewigen Miteinander und Gegenüber zum Lobpreis Gottes
existiert. Die Identität von irdischem und himmlischem Leib wird
allein durch das schöpferische gnädige Gedächtnis Gottes gewahrt. |
| In der anschließenden
lebhaften Diskussion wurde angemerkt, dass Metamorphose nur als
positive Verwandlung erläutert wurde. Es seien aber auch dramatische
Veränderungen zum Schlechten möglich. Angesichts der dadurch
entstehenden Ängste seien die Tröstung und Ermutigung durch die
besondere Nähe des Christusereignisses im Empfang des Altarsakraments
kostbar. |
 |
 |
| nach
oben |
Text: kh, Fotos: dr&gm |
|
Samstag,
9. September 2017
16:00

Sr. Katharina Deifel

Heinz Nussbaumer,

Tarafa Baghajati
 |
 Metamorphose unserer
Gesellschaft - Schlagwort „Christliches Abendland“: Wie christlich ist
der Westen aus eigener Sicht und in den Augen Andersgläubiger ? Metamorphose unserer
Gesellschaft - Schlagwort „Christliches Abendland“: Wie christlich ist
der Westen aus eigener Sicht und in den Augen Andersgläubiger ?
Diskussion mit Prof.
Heinz Nussbaumer,
Tarafa
Baghajati
und
Sr. Katharina Deifel -
Moderation
Rudolf Nagiller |
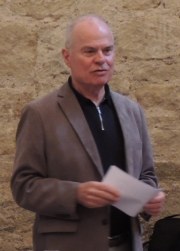 Bei
der von Dr. Rudolf Nagiller geleiteten Diskussion erklärte der
Moderator zuerst den Begriff des „christlichen Abendlandes“ und dessen
inhaltliche Veränderungen bis in die Gegenwart, daraus entstehende
Unsicherheiten und Ängste und bat dann die einzelnen Diskutanten um
ihre Einschätzung der momentanen Situation und die wichtigsten
„Baustellen“. Sr. Katharina sprach vom eigentlich ursprünglich
„christlichen Morgenland“, das heute nur mehr christliche Minderheiten
beherbergt, die in teilweise prekären Situationen leben und davon,
dass die Säkularisierung unserer Gesellschaft in ihren Augen eine
gewisse Verbesserung der Situation gebracht hat, da eine klare
Trennung von Staat und Religion erfolgt ist. Dies sieht sie auch als
wichtigsten Punkt für ein friedliches Zusammenleben einer kommenden
Gesellschaft in Europa, aber auch als größte Hürde an, da in der
muslimischen Welt keine eindeutige Lehrmeinung wie z.B. in der
katholischen Kirche zu finden ist. Bei
der von Dr. Rudolf Nagiller geleiteten Diskussion erklärte der
Moderator zuerst den Begriff des „christlichen Abendlandes“ und dessen
inhaltliche Veränderungen bis in die Gegenwart, daraus entstehende
Unsicherheiten und Ängste und bat dann die einzelnen Diskutanten um
ihre Einschätzung der momentanen Situation und die wichtigsten
„Baustellen“. Sr. Katharina sprach vom eigentlich ursprünglich
„christlichen Morgenland“, das heute nur mehr christliche Minderheiten
beherbergt, die in teilweise prekären Situationen leben und davon,
dass die Säkularisierung unserer Gesellschaft in ihren Augen eine
gewisse Verbesserung der Situation gebracht hat, da eine klare
Trennung von Staat und Religion erfolgt ist. Dies sieht sie auch als
wichtigsten Punkt für ein friedliches Zusammenleben einer kommenden
Gesellschaft in Europa, aber auch als größte Hürde an, da in der
muslimischen Welt keine eindeutige Lehrmeinung wie z.B. in der
katholischen Kirche zu finden ist.
 Prof.
Nussbaumer sieht die Problematik darin, dass mehrheitlich islamische
Gesellschaften die Befürchtung haben, dass eine wirtschaftlich
erfolgreiche Gesellschaft offensichtlich mit einer Säkularisierung
einhergeht und meinte, dass in vielen Teilen des Westens Religion und
Glaube nicht mehr so offensichtlich sind wie in islamischen Ländern,
was bei Muslimen zu einer möglicherweise falschen Einschätzung unserer
Werte führen kann, die für uns nicht mehr direkt mit der christlichen
Religion in Zusammenhang gebracht werden. DI Baghajati begann damit,
dass junge Muslime in Österreich Christentum in erster Linie mit
Islamablehnung in Verbindung bringen, was offenbar aus den einseitigen
Medienmeldungen zu erklären ist. Er meinte, dass nur eine
vorurteilfreie Begegnung zu einem echten Miteinander in der
Gesellschaft führen kann. Er wies darauf hin, dass er beobachtet hat,
dass Flüchtlinge, die aus Krisengebieten des Nahen Ostens nach
Österreich kommen, sich oft wesentlich schneller in die bestehende
Gesellschaft integrieren als Familien, die schon 20 Jahre oder länger
hier sind und teilweise in Parallelgesellschaften leben. Er versucht
das durch die Arbeit des IMÖ (Initiative muslimischer
Österreicherinnen und Österreicher) zu verbessern und
Aufklärungsarbeit in beide Richtungen zu machen. Prof.
Nussbaumer sieht die Problematik darin, dass mehrheitlich islamische
Gesellschaften die Befürchtung haben, dass eine wirtschaftlich
erfolgreiche Gesellschaft offensichtlich mit einer Säkularisierung
einhergeht und meinte, dass in vielen Teilen des Westens Religion und
Glaube nicht mehr so offensichtlich sind wie in islamischen Ländern,
was bei Muslimen zu einer möglicherweise falschen Einschätzung unserer
Werte führen kann, die für uns nicht mehr direkt mit der christlichen
Religion in Zusammenhang gebracht werden. DI Baghajati begann damit,
dass junge Muslime in Österreich Christentum in erster Linie mit
Islamablehnung in Verbindung bringen, was offenbar aus den einseitigen
Medienmeldungen zu erklären ist. Er meinte, dass nur eine
vorurteilfreie Begegnung zu einem echten Miteinander in der
Gesellschaft führen kann. Er wies darauf hin, dass er beobachtet hat,
dass Flüchtlinge, die aus Krisengebieten des Nahen Ostens nach
Österreich kommen, sich oft wesentlich schneller in die bestehende
Gesellschaft integrieren als Familien, die schon 20 Jahre oder länger
hier sind und teilweise in Parallelgesellschaften leben. Er versucht
das durch die Arbeit des IMÖ (Initiative muslimischer
Österreicherinnen und Österreicher) zu verbessern und
Aufklärungsarbeit in beide Richtungen zu machen.
In der nachfolgenden Diskussion mit reger
Publikumsbeteiligung , die von Dr. Nagiller souverän geleitet wurde,
kamen persönliche Beobachtungen und Erfahrungen zur Sprache, die
Vorurteile auf allen Seiten manchmal verstärken oder auch abbauen
können und es wurde klar, dass Europa und auch Österreich unruhigen
Zeiten entgegen geht, bis sich hoffentlich ein stabiles und von
Vertrauen getragenes Zusammenleben entwickeln wird. |
 |
 |
| nach
oben |
Text: dr, Fotos: gm |
|
Samstag,
9./10. September 2017
Claudia Rehberger,
Olive4U
sorgte mit
ihrem Buffet für Erfrischung und Labung und zur
Verkürzung der Wartezeit
 |
|
Samstag,
9. September 2017
18:30
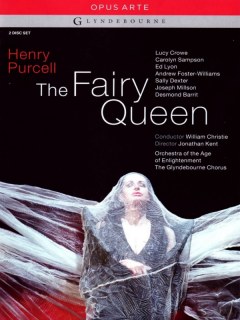
 |
|
Sonntag,
10. September 2017
11:30

Ein bitterernster Streifzug quer durch die Literatur von Welt -
von und mit
Wolfgang Ritzberger
|
|
Sonntag,
10. September 2017
14:00
Margareta
Divjak-Mirwald


 |
|
Sonntag,
10. September 2017
15:30

Trailer zum ansehen
Richard
Wilhelm wurde 1873 geboren, studierte Theologie, und ging 1899 als
Missionar ins chinesische Qingdao. Am Ende verbrachte er fast ein
Vierteljahrhundert in China.
In dieser Zeit taufte Richard Wilhelm keinen
einzigen Chinesen – stattdessen tauchte er tief in die Geisteswelt
seines Gastlandes ein. Und er begann, die klassischen Werke des
antiken Chinas ins Deutsche zu übertragen : unter anderen Konfuzius,
die daoistischen Klassiker, das Orakelwerk Buch der Wandlungen ,
bekannt im Westen auch als I Ging .
(Quelle:
http://www.zeit.de) |
|
FILM, Wandlungen – Richard Wilhelm und
das I Ging |
|
Bettina Wilhelm drehte
einen Dokumentarfilm über ihren Großvater Richard Wilhelm
(1873-1930)
und seine Tätigkeiten und Kontakte im China des
beginnenden 20. Jahrhunderts.
In stimmungsvollen Bildern zeigt sie alte Fotografien und
Filmaufnahmen kombiniert mit Eindrücken aus dem heutigen China.
Sie interviewt Nachkommen von Mitarbeitern ihres Großvaters und
Experten der chinesischen Philosophie. Richard Wilhelm lernte in
kurzer Zeit die chinesische Sprache perfekt und konzentrierte sich
immer mehr auf Übersetzungen alter philosophischer Texte, unter
anderem des I Ging, das so erstmals in den Westen kam. Seine
eigentliche Tätigkeit als protestantischer Missionar wurde ihm immer
unwichtiger, je tiefer er in die Geschichte Chinas eindrang. Auf
vielfältige Art versucht Bettina Wilhelm das Geheimnis des „Buchs der
Wandlungen“ zu vermitteln und auch die wechselvollen Beziehungen
zwischen Deutschland und China zur Zeit des Ersten Weltkriegs
nachzuzeichnen. Eindringliche Bilder zeigen einen Teil der
Weltgeschichte, der uns eher weniger geläufig ist. |

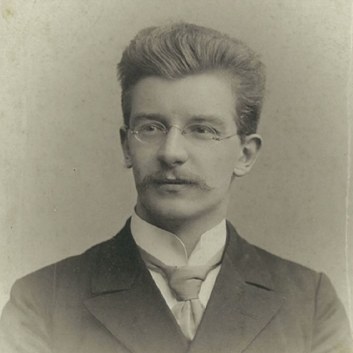
 |
| nach
oben |
Text: df, Fotos: gm |
|
Sonntag,
10. September 2017
17:30
Annemarie Ortner
und Freunde

Richard Strauss
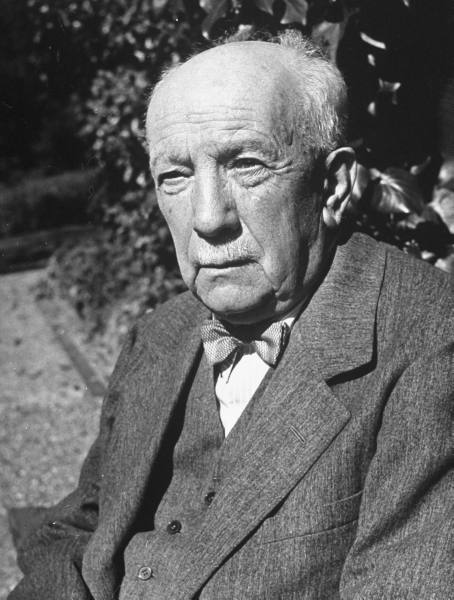
Im Herbst 1944 nahm Strauss, vermittelt über den
Musikwissenschaftler Willi Schuh, einen Kompositionsauftrag Paul Sachers
an und notierte als Ausgangsidee „Trauer um München“ in sein Skizzenbuch,
auf das er 1945 zurückgriff. Besonders die Zerstörung des Münchner
Nationaltheaters, seiner langjährigen Wirkungsstätte, vom 3. auf den 4.
Oktober 1943 erschütterte ihn. Hatte er zunächst an ein Septett gedacht,
erweiterte er die Besetzung später auf zehn Violinen, fünf Bratschen und
Violoncelli sowie drei Kontrabässe, um so die Klangfarben weiter
ausdifferenzieren und intensivieren zu können. (Quelle:
Wikipedia)
|
Richard
Strauss, “ Metamorphosen”, in der Version für Streichseptett
1.Violine Annemarie Ortner –Kläring, 2.Violine Anne Harvey-Nagl
1.Viola Lena Fankhauser-Campregher, 2.Viola Raphael Handschuh
1.Cello Solveig Nordmeyer, 2.Cello Johannes Kubitschek
Kontrabaß Tommaso Huber |
|
Annemarie Ortner begann den
musikalischen Abschluss von Kunst im Karner mit einer kurzen
Einführung zu Richard Strauss`Spätwerk „Metamorphosen“. 1943 begonnen
für ein kleines Streicherensemble wurde die Besetzung bald auf 23
Streicher erweitert. Strauss legte in dieses Werk seine ganze
Verzweiflung und Depression seiner persönlichen Situation gegen Ende
des Krieges als auch zur allgemeinen Zerstörung seiner Heimatstadt
München und weiter Teile Deutschlands hinein.
Seine glanzvolle Karriere lag in Trümmern, genauso wie die Städte. Er
versuchte dies durch immer wieder kehrende absteigende Tonfolgen zu
erreichen und beendete das Stück mit einem sehr kurzen Zitat aus
Beethovens Eroica, dem Trauermarch. Die in der europäischen Musik
schon lange verwendete Rhythmusformel der „umgekehrten Punktierung“
hat einen schleppenden und sehr depressiven Charakter und stellt eine
Anspielung auf das allgemeine Ende dar. Wie weit Strauss dieses Stück
als Abgesang auf die Nazizeitverstanden hat oder hauptsächlich seine
persönliche Situation meinte, ist nicht ganz klar nachweisbar.
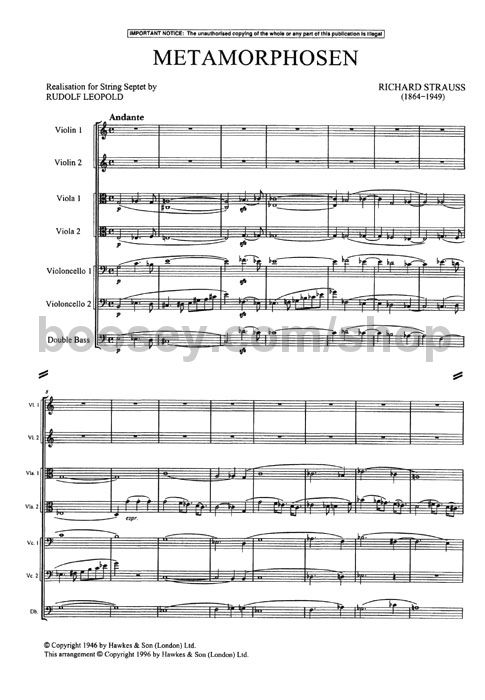
In der sehr dichten Atmosphäre des
Karners erschloss sich jedenfalls dem Publikum ein extrem intensiver
Hörgenuss, der zusammen mit den ausgestellten Tapisserien von Franka
Lechner eine ganz besondere Atmosphäre verbreitete. Sichtlich berührt
verließen die Besucher nach 40 Minuten den Karner, um am Kirchenplatz
noch die musikalischen und farbigen Bilder nachklingen zu lassen |





 |
| nach
oben |
Text: df & Wikipedia, Fotos: gm |
|
|
|
|
Die Inhalte dieser Webseite sind
ausschließlich für private Nutzung erlaubt. Inhalte, das heisst Text oder
Bilder, dürfen nicht zum Teil oder als Ganzes ohne Erlaubnis
verwendet werden, da diese urheberrechtlich geschützt sind. |
|
Impressum - Für mehr Informationen schreiben sie
bitte an
kunst-im-karner@othmar.at
|