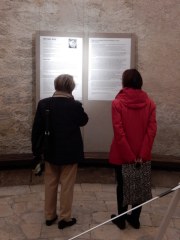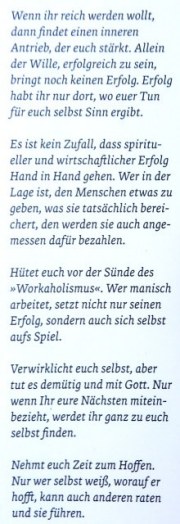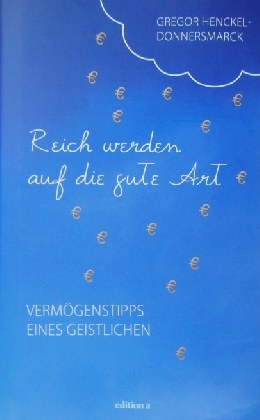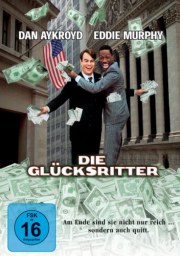Übersicht alle
bisherigen Ausstellungen
Startseite othmar.at |
KIK Fotos und Berichte
|

|
12. September 2014
Vernissage
Begrüßung: Doris
Reiser

Eröffnung VizeBgm
Ferdinand Rubel

Einführung:
Günther Oberhollenzer



Musik:
Stefan Heckel





Vizebürgermeister Ferdinand Rubel &
Pfarrer Richard Posch
 Günther Oberhollenzer
& Michael Kos vor der Vernissage im Karner
 |
|
Nach der Eröffnung der Ausstellung durch
Vizebürgermeister KR Ferdinand Rubel, der auch zugleich
Patronatskommissär der Gemeinde ist und die wechselhafte Geschichte
der Mödlinger Pfarre, auch in pekunieärer Weise, zum Ausdruck brachte,
wurde das Publikum in den Karner gebeten. Die Installation von Michael
Kos beeindruckte nicht nur durch die Christusdarstellung, die auf
einer Slackline zu schweben scheint, sondern auch durch die Windstöße,
die - durch eine Windmaschine erzeugt – den Raum in eigenartiger Weise
belebten. Stefan Heckel spielte mit seinem Akkordeon zuerst mit der
Windmaschine, später auch gegen sie an und umtänzelte mit seinem
Instrument quasi die Installation. Diese sehr dichte und bewegte
Atmosphäre versetzte die Besucher in die richtige Aufnahmebereitschaft
für die einführenden Worte von Günther Oberhollenzer, der schon
längere Zeit Michael Kos und sein künstlerisches Schaffen begleitet.
Er wies darauf hin, dass Kos immer wieder überraschend für ihn Objekte
neu verknüpft und so Assoziationen aufkommen lässt, die mit der
ursprünglichen Bedeutung der Dinge wenig zu tun haben, diese aber
trotzdem auch präsent sind. Bei wunderschönem Herbstwetter klang die
Vernissage am Kirchenplatz aus, als bereits die ersten Besucher für
die Filmvorführung des Rahmenprogramms einen Blick in den Karner
machten und sich mit der Installation auf den Film einstimmten. |
 |
 |
|
Eröffnungsrede von Günther Oberhollenzer
(Essl Museum) |
 Es
ist mir eine Freude, einige Worte zur der Installation „balanceAKT“
von Michael Kos sagen zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung! Es
ist mir eine Freude, einige Worte zur der Installation „balanceAKT“
von Michael Kos sagen zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung!
Ich schätze den Karner in Mödling als Ausstellungsort, als Ort der
Begegnung und Diskussion. Doris Reiser hat auch dieses Mal mit viel
Leidenschaft und Idealismus Beeindruckendes auf die Beine gestellt hat
– mit dieser Ausstellung, mit dem umfangreichen Rahmenprogramm.
Viele Künstlerinnen und Künstler haben schon den Karner bespielt. Es
war und ist jedes Mal eine große Herausforderung, denn eine romanische
Kapelle ist natürlich ein ganz besonderer Ort. Es ist ein Unterschied,
ob wir eine zeitgenössische Kunstausstellung in einem Museum, in einer
Galerie, in einem weißen, neutralen Raum besuchen, oder aber hier, an
einem religiös und geschichtlich aufgeladenen Ort – einem Ort auch,
dem mit Respekt und nötigem Feingefühl begegnet werden sollte. Doch
genau das ist das Spannende am Projekt „Kunst im Karner“. Es ist
dieser besondere Raum – und damit verbunden der reizvolle, nicht
einfache Versuch, zeitgenössische Kunst in Dialog mit religiösen
Themen zu bringen, eine Brücke zwischen Kunst und Kirche zu bauen.
 Heute
sehen wir Arbeiten von Michael Kos unter dem schönen Titel „balanceAKT“.
Ich begleite die Arbeiten von Kos seit einigen Jahren, und bin jedes
Mal aufs Neue überrascht, wie vielfältig und facettenreich er sich
seinen künstlerischen Themen nähert. In der zu sehenden Arbeit ist der
Künstler – und das macht sicher eine ihrer Stärken aus – auf den Raum
eingegangen. Es ist eine Installation, die in dieser Form auch nur
hier „funktioniert“, die man nicht ohne weiteres irgendwo andere
genauso zeigen könnte. „Der Raum hat auf diese Arbeit gewartet“,
erzählt Kos. Heute
sehen wir Arbeiten von Michael Kos unter dem schönen Titel „balanceAKT“.
Ich begleite die Arbeiten von Kos seit einigen Jahren, und bin jedes
Mal aufs Neue überrascht, wie vielfältig und facettenreich er sich
seinen künstlerischen Themen nähert. In der zu sehenden Arbeit ist der
Künstler – und das macht sicher eine ihrer Stärken aus – auf den Raum
eingegangen. Es ist eine Installation, die in dieser Form auch nur
hier „funktioniert“, die man nicht ohne weiteres irgendwo andere
genauso zeigen könnte. „Der Raum hat auf diese Arbeit gewartet“,
erzählt Kos.
Was sehen wir? Auf einer klassischen Slackline balanciert eine
Christusfigur. Eine Slackline ist ein breites Band, das z.B. zwischen
zwei Bäumen gespannt wird (oder, die extreme Variante, im Hochgebirge
zwischen zwei Felsen), und der Slackliner versucht, über das Band zu
gehen, die Balance zu halten. Hier hingegen sehen wir eine
Christusfigur. Der lebensgroße Corpus ist weiß bemalt und in seiner
Form traditionell geschnitzt, aber das Kreuz fehlt und auch die
Wundmale. So bekommt die Geste der Hände und Arme eine ganz neue
Bedeutung und erinnert tatsächlich an jemanden, der versucht, das
Gleichgewicht zu halten. |
 Der
Corpus Christi und das Kreuz sind Symbole, die wie kam andere in
unserer Kultur und Geschichte verankert sind. Das Kreuz ist das
Hauptsinnzeichen des Christentums. „Man komme“, so Kos, „als Künstler
an diesem Zeichen nicht vorbei, man müsse sich mit ihm beschäftigen,
sich auch daran reiben.“ Schon in seinen sogenannten
„Körperkreuzungen“ von 2012 splittert der Künstler das Kreuz als auch
den Corpus auf und setzt die Teile ähnlich einer Metamorphose in
überraschenden Konstellationen neu zusammen. Kos lässt dadurch eine
neue, originäre Körperlichkeit entstehen und hinterfragt damit – wie
auch bei der Arbeit im Karner – den tradierten skulpturalen Charakter
des Kreuzes. Der Künstler nimmt hier das Achsenkreuz weg und fügt eine
andere Achse, eine Gleichgewichtsachse hinzu. Durch diesen Eingriff
verändert sich die Skulptur in seinem Sinngehalt. Einerseits sehen wir
noch den gekreuzigten Christus, anderseits sehen wir aber auch etwas
anderes, Neues... Der
Corpus Christi und das Kreuz sind Symbole, die wie kam andere in
unserer Kultur und Geschichte verankert sind. Das Kreuz ist das
Hauptsinnzeichen des Christentums. „Man komme“, so Kos, „als Künstler
an diesem Zeichen nicht vorbei, man müsse sich mit ihm beschäftigen,
sich auch daran reiben.“ Schon in seinen sogenannten
„Körperkreuzungen“ von 2012 splittert der Künstler das Kreuz als auch
den Corpus auf und setzt die Teile ähnlich einer Metamorphose in
überraschenden Konstellationen neu zusammen. Kos lässt dadurch eine
neue, originäre Körperlichkeit entstehen und hinterfragt damit – wie
auch bei der Arbeit im Karner – den tradierten skulpturalen Charakter
des Kreuzes. Der Künstler nimmt hier das Achsenkreuz weg und fügt eine
andere Achse, eine Gleichgewichtsachse hinzu. Durch diesen Eingriff
verändert sich die Skulptur in seinem Sinngehalt. Einerseits sehen wir
noch den gekreuzigten Christus, anderseits sehen wir aber auch etwas
anderes, Neues...
Das ist ein Kunstgriff, denn Kos immer wieder anwendet: er
transformiert vorgefundene Objekte und verändert damit auch seine
Bedeutung. So hat er z.B. Steine, ganz normale Findlinge, mit
Gummiseilen vernäht oder sie mit Antennen und Kabeln versehen und
ihnen dadurch eine unheimlich technoiden oder auch rätselhaft
organischen Charakter verliehen. |
 Zurück
zur Christusfigur. Durch die Transformation fordert Kos uns auf,
genauer hinsehen: Gerade durch die Veränderung des Kreuzes, werden wir
uns dessen ursprünglichen Aussehens wieder stärker bewusst. Wie zeigen
wir Menschen die christliche Figur, in welcher figurativen Form, mit
welcher Körpersprache? Wie wird der Körper, der Akt dafür benutzt?
Oder, noch tiefer gehend: Wie hat sich die Darstellung des Kreuzes im
Laufe der Zeit verändert: vom Christus als König in der Romanik über
den leidenden, Empathie hervorrufenden Christus in der Gotik bis zu
den vielfältigen Christusdarstellungen in der heutigen Zeit? Zurück
zur Christusfigur. Durch die Transformation fordert Kos uns auf,
genauer hinsehen: Gerade durch die Veränderung des Kreuzes, werden wir
uns dessen ursprünglichen Aussehens wieder stärker bewusst. Wie zeigen
wir Menschen die christliche Figur, in welcher figurativen Form, mit
welcher Körpersprache? Wie wird der Körper, der Akt dafür benutzt?
Oder, noch tiefer gehend: Wie hat sich die Darstellung des Kreuzes im
Laufe der Zeit verändert: vom Christus als König in der Romanik über
den leidenden, Empathie hervorrufenden Christus in der Gotik bis zu
den vielfältigen Christusdarstellungen in der heutigen Zeit?
 Auch
der Tabernakel wird transformiert: Anstelle eines Tabernakels sehen
wird einen Tresor, die darin aufbewahrten Hostien erinnern an
Geldmünzen. Sie sind mit der Zahl 1 und dem Satz „Geld ist die soziale
Transsubstanz“ bedruckt. Das Geld als neue Religion? Auch
der Tabernakel wird transformiert: Anstelle eines Tabernakels sehen
wird einen Tresor, die darin aufbewahrten Hostien erinnern an
Geldmünzen. Sie sind mit der Zahl 1 und dem Satz „Geld ist die soziale
Transsubstanz“ bedruckt. Das Geld als neue Religion?
„Transsubstanz“ meint das Transformieren einer leiblichen Substanz in
eine andere. Das Geld, so Kos, ist in seiner Rolle als Tausch- und
Zahlungsmittel einem ständigen Wandel ausgesetzt. Geld ist im
Idealfall ausgleichend: Ware wird für einen festgelegten Geldbetrag
getauscht bzw. verkauft. Doch das Geldsystem gerät zunehmend aus den
Fugen. Das Geld wird selbst zur Ware, es vermehrt sich, ohne dass nach
einer Leistung gefragt wird, es vermehrt sich durch Scheingeschäfte,
Scheininvestitionen und -immobilien. Man lässt „das Geld für sich
arbeiten“. Doch auf Kosten von wem? Dann aber platzt die
Spekulationsblase. Die Welt scheint aus dem Gleichgewicht – und das
betrifft nicht nur den Kapitalmarkt. |
 Damit
verwebt Kos in seiner Installation religiöse Symbolik mit
gesellschaftssozialen Fragen. Der balancierende Christus steht für das
Gleichgewicht in unserer Gesellschaft – oder vielmehr, er warnt vor
dem Verlust dieses Gleichgewichtes, vor der Ungleichheit der
Verteilung der Güter in unserer Welt, in der wenigen viel gehört und
vielen wenig. Dieser Christus ist aber in noch so vielerlei Hinsicht
interpretierbar: wir können darin auch schwankende Werte sehen, eine
Zeit des Wandels, in der viele Sicherheiten brüchig werden... Damit
verwebt Kos in seiner Installation religiöse Symbolik mit
gesellschaftssozialen Fragen. Der balancierende Christus steht für das
Gleichgewicht in unserer Gesellschaft – oder vielmehr, er warnt vor
dem Verlust dieses Gleichgewichtes, vor der Ungleichheit der
Verteilung der Güter in unserer Welt, in der wenigen viel gehört und
vielen wenig. Dieser Christus ist aber in noch so vielerlei Hinsicht
interpretierbar: wir können darin auch schwankende Werte sehen, eine
Zeit des Wandels, in der viele Sicherheiten brüchig werden...
Natürlich muss man auch an die Gerechtigkeit denken. Denn
Gleichgewicht bzw. Ungleichgewicht führt unweigerlich zur Frage nach
der Gerechtigkeit, und zur Frage, ob unser Anspruch, dass alle
Menschen gleich sind, letztendlich nur ein leeres Versprechen ist.
Eine Frage, die nicht zuletzt aufgrund der jüngsten Ereignisse, nicht
laut genug gestellt werden kann.
 Die
Installation wirkt sehr fragil, es scheint sehr anstrengend zu sein,
das Gleichgewicht zu halten. Zusätzlich ist im Ausstellungsraum ein
leichter Wind zu spüren, verursacht von einer Windmaschine. Kos war es
wichtig, neben statischen Objekten auch ein dynamisches, immaterielles
Element zuzulassen – ein Element, das den Corpus in leichte, kaum
sichtbare Schwingungen versetzt. Die
Installation wirkt sehr fragil, es scheint sehr anstrengend zu sein,
das Gleichgewicht zu halten. Zusätzlich ist im Ausstellungsraum ein
leichter Wind zu spüren, verursacht von einer Windmaschine. Kos war es
wichtig, neben statischen Objekten auch ein dynamisches, immaterielles
Element zuzulassen – ein Element, das den Corpus in leichte, kaum
sichtbare Schwingungen versetzt. |
 „Ein Wind kommt auf“: ein Zeichen, das wir aus der Bibel her kennen.
So wird etwa das Kommen des Heiligen Geistes gerne als Wind und Atem
beschrieben. In der Apostelgeschichte, Kapitel 2,2/3 heißt es (das
Pfingstwunder): „Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie
von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie
saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. ...“ In
der Ausstellung bringt der Wind dagegen Unruhe in das Geschehen.
„Ein Wind kommt auf“: ein Zeichen, das wir aus der Bibel her kennen.
So wird etwa das Kommen des Heiligen Geistes gerne als Wind und Atem
beschrieben. In der Apostelgeschichte, Kapitel 2,2/3 heißt es (das
Pfingstwunder): „Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie
von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie
saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. ...“ In
der Ausstellung bringt der Wind dagegen Unruhe in das Geschehen.
Michael Kos bespielt einen kirchlichen Raum, der nicht mehr für die
religiöse Zwecke genützt wird und transformiert christliche Symbole in
einen zeitgenössischen Kontext. Gleichzeitig aber reflektiert er auch
wichtige Themen der Kirche, etwa die Ungleichheit zwischen Arm und
Reich.
Natürlich, bei Projekten dieser Art gibt es von künstlerischer wie
kirchlicher Seite immer wieder Vorbehalte. Einerseits die Sorge, dass
die künstlerische Autonomie beschnitten wird, andererseits, dass die
Kunst sich religionskritisch äußert. Doch es kann, wie hier wunderbar
zu sehen ist, zu einem gewinnbringenden Dialog zwischen Kunst und
Religion kommen. Das gelingt, wenn man sich gegenseitig respektiert
und einfach versucht, neugierig aufeinander zu sein. Seien wir
neugierig!
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Betrachten und Nachdenken!
Günther Oberhollenzer |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
nach
oben |
(Text: dr & Günther Oberhollenzer, Fotos:gm
& Michael Kos) |
|
12. September
2015
„Der große Crash - Margin Call“
mit
Wolfgang Ritzberger

| Als Gymnasiast war
Wolfgang Ritzberger schon freier Mitarbeiter des ORF, danach Redakteur
und Moderator bei Ö3, in der Wissenschafts-redaktion
des Hörfunks, beim Kinderfunk und beim Familienfunk von Radio Wien. |
| Ab 1984 aktueller
Dienst des Landesstudios Nieder-österreich als
ständiger, freier Mitarbeiter (Hörfunk u. Fernsehen als Reporter,
Redakteur, Chef vom Dienst, Moderator und Regisseur in fast allen
Formen der aktuellen Berichterstattung). |
| Ab 1991 angestellt in
der »ZIB 2« (mitverantwortlich für die Gestaltung der »ZIB 2« und den
Aufbau der in die »ZIB 2« integrierten Diskussionssendung »Der runde
Tisch«). |
| 1993 Präsenzdienst als
Leistungssportler in der »Heeres Sport- und Nahkampfschule« (Ritzberger
war Mitglied der öster-reichischen Nationalmann-schaft
im Säbelfechten, Staatsmeister, WM-Teilnehmer, Trainer-ausbildung,
1995 beendete er seine sportliche Laufbahn). |
|
1995 bis 1996
Gesellschafter einer Werbe- u. Kommunikationsagentur. |
| 1996, nach Beendigung
einer Bildungskarenz und des Präsenzdienstes, machte der ORF
Ritzberger das Angebot, ihn aus seinem Dienstvertrag, abgeschlossen
nach der alten »Freien Betriebsverein-barung«,
auszukaufen. Nach kurzer Bedenkzeit nimmt er das Angebot an, um sich
selbstständig zu machen |
| Ab 1996 freier
Regisseur und Autor (Werbespots und Industriefilme, Veranstaltungen),
Kabarettist (4 Programme als „Theuer & Schlächt“ gemeinsam mit Guido
Mancusi (www.mancusi.at) und Buchautor („Die Beiseln der Wiener“). |
| 2000 Gründung der
eigenen Produktionsfirma »RitzlFilm« |
|
Quelle:
www.ritzfilm.at |
|
|
Filmabend: The margin call"
(Der große Crash)
2001, R: Jeffrey Chandor -
deutscher Trailer hier |
|
 Der
Film wurde von etlichen Kritikern als der bis jetzt beste Beitrag des
fiktionalen Kinos zum Thema Finanzkrise bezeichnet. Regisseur und
Drehbuchautor Jeffrey Chandor hat dabei sicher auch auf die
Erfahrungen seines Vaters, der als Börsenmakler arbeitet, zurück
gegriffen. Chandor schildert den Ausbruch der Finanzkrise in einer
fiktiven, international tätigen Investmentbank in New York. In weniger
als 36 Stunden entscheidet sich nicht nur das Schicksal der Bank,
sondern auch das von tausenden Menschen und streng genommen der
Finanzwirtschaft selbst. Ein junger Mitarbeiter entdeckt dass die Bank
in Wahrheit Pleite ist, weil sie eine Menge wertloser, in den Bücher
aber überbewerteter, Immobilieninvestments hält. In der Nacht noch
wird der Vorstand einberufen und beschließt, die wertlosen Papier
koste es was es wolle am nächsten Morgen auf den Markt zu werfen. Die
Konsequenzen, ein Crash des Marktes und der Verlust der
Glaubwürdigkeit der involvierten Händler, nimmt der Vorstand in Kauf.
Gegen Ende des Filmes wird erkennbar, dass der Vorstandsvorsitzende
damit sogar noch Geld verdient hat. Der
Film wurde von etlichen Kritikern als der bis jetzt beste Beitrag des
fiktionalen Kinos zum Thema Finanzkrise bezeichnet. Regisseur und
Drehbuchautor Jeffrey Chandor hat dabei sicher auch auf die
Erfahrungen seines Vaters, der als Börsenmakler arbeitet, zurück
gegriffen. Chandor schildert den Ausbruch der Finanzkrise in einer
fiktiven, international tätigen Investmentbank in New York. In weniger
als 36 Stunden entscheidet sich nicht nur das Schicksal der Bank,
sondern auch das von tausenden Menschen und streng genommen der
Finanzwirtschaft selbst. Ein junger Mitarbeiter entdeckt dass die Bank
in Wahrheit Pleite ist, weil sie eine Menge wertloser, in den Bücher
aber überbewerteter, Immobilieninvestments hält. In der Nacht noch
wird der Vorstand einberufen und beschließt, die wertlosen Papier
koste es was es wolle am nächsten Morgen auf den Markt zu werfen. Die
Konsequenzen, ein Crash des Marktes und der Verlust der
Glaubwürdigkeit der involvierten Händler, nimmt der Vorstand in Kauf.
Gegen Ende des Filmes wird erkennbar, dass der Vorstandsvorsitzende
damit sogar noch Geld verdient hat. |
|
 Produziert
wurde der Film von Open Doors Pictures, der Produktionsfirma des
Schauspielers Zachary Quinto, der als Mr. Spock in den Star Trek Spin
Offs von J.J. Abrahams in den letzten Jahren bekannt wurde. Quinto
spielt auch an der Seite von Stars wie Kevin Spacey, Paul Bettany,
Demi Moore, Stanley Tucci und Jeremy Ironside den jungen
Wissenschafter, der das Desaster entdeckt. Die Figur des
Vorstandsvorsitzenden, den Jeremy Ironside darstellt, ist dem CEO und
Chairman Richard Fuld nachempfunden - dem letzten Chef der Lehman
Brothers, die als Auslöser der Krise gelten und schließlich in Konkurs
gingen. Der damalige Finanzminister der USA war der Produziert
wurde der Film von Open Doors Pictures, der Produktionsfirma des
Schauspielers Zachary Quinto, der als Mr. Spock in den Star Trek Spin
Offs von J.J. Abrahams in den letzten Jahren bekannt wurde. Quinto
spielt auch an der Seite von Stars wie Kevin Spacey, Paul Bettany,
Demi Moore, Stanley Tucci und Jeremy Ironside den jungen
Wissenschafter, der das Desaster entdeckt. Die Figur des
Vorstandsvorsitzenden, den Jeremy Ironside darstellt, ist dem CEO und
Chairman Richard Fuld nachempfunden - dem letzten Chef der Lehman
Brothers, die als Auslöser der Krise gelten und schließlich in Konkurs
gingen. Der damalige Finanzminister der USA war der
 ehem.
CEO von Morgan Stanley (dem großen Konkurrenten der Lehman Brothers),
die ihn den gleichen Schwierigkeiten steckten und sozusagen vom Staat
gerettet wurden. Der Film hatte in den USA keinen großen Erfolg beim
Publikum: ca. 2,5 Millionen Dollar Herstellungskosten stehen Box
Office Einnahmen von knapp 3,5 Millionen gegenüber. Weltweit spielte
der Film allerdings mehr als 14 Millionen Dollar ein, was für die
Produktionsfirma am Ende doch einen kleinen
Gewinn bedeutete (nur ca. 25% der Einspielergebnisse bekommt die
Produktionsfirma, weitere 25% bekommt in der Regel der ehem.
CEO von Morgan Stanley (dem großen Konkurrenten der Lehman Brothers),
die ihn den gleichen Schwierigkeiten steckten und sozusagen vom Staat
gerettet wurden. Der Film hatte in den USA keinen großen Erfolg beim
Publikum: ca. 2,5 Millionen Dollar Herstellungskosten stehen Box
Office Einnahmen von knapp 3,5 Millionen gegenüber. Weltweit spielte
der Film allerdings mehr als 14 Millionen Dollar ein, was für die
Produktionsfirma am Ende doch einen kleinen
Gewinn bedeutete (nur ca. 25% der Einspielergebnisse bekommt die
Produktionsfirma, weitere 25% bekommt in der Regel der
 Verleih
und 50%, also die Hälfte der Einnahmen, das Lichtspieltheater). Der
Grund dafür ist wahrscheinlich in der Tatsache zu suchen, dass den
US-Amerikanern das Thema zu heikel und außerdem unangenehm ist. Die
USA ruhen seit ihrer Gründung nicht auf ideologischen Ideen sondern
auf den Säulen des Dollars (die Gründer der USA
konnten etliche Bundesstaaten nur zum Mitmachen überzeugen, weil sie
deren Schulden aus dem Unabhängigkeitskrieg übernahmen und
gleichzeitig die Notenpresse anwarfen), auch Hollywood gehört zum Teil
Investmentfonds, Holdings und Banken, da kommt die Beschäftigung mit
einem solchen Thema nicht so gut an. Trotzdem wurde der Film für den
Oscar für das beste Drehbuch nominiert und in Berlin für den Goldenen
Löwen. Verleih
und 50%, also die Hälfte der Einnahmen, das Lichtspieltheater). Der
Grund dafür ist wahrscheinlich in der Tatsache zu suchen, dass den
US-Amerikanern das Thema zu heikel und außerdem unangenehm ist. Die
USA ruhen seit ihrer Gründung nicht auf ideologischen Ideen sondern
auf den Säulen des Dollars (die Gründer der USA
konnten etliche Bundesstaaten nur zum Mitmachen überzeugen, weil sie
deren Schulden aus dem Unabhängigkeitskrieg übernahmen und
gleichzeitig die Notenpresse anwarfen), auch Hollywood gehört zum Teil
Investmentfonds, Holdings und Banken, da kommt die Beschäftigung mit
einem solchen Thema nicht so gut an. Trotzdem wurde der Film für den
Oscar für das beste Drehbuch nominiert und in Berlin für den Goldenen
Löwen. |
|
Insgesamt hat der Film vor allem in den
USA 6 Preise gewonnen, vor allem Kritikerpreise und Indipendent Awards.
Offiziell wird es nicht bestätigt, aber ein Großteil der Schauspieler
sollen auf ihre Gage verzichtet, im Gegenteil, sogar in den Film
investiert haben. Regisseur Chandor hat damit jedenfalls ein
beachtliches Debüt zu Stande gebracht, auch sein zweiter Film "All is
lost", mit Robert Redford als einsamen Segler auf einer havarierten
Segelyacht mitten auf dem Pazifik, wurde für einen Oscar und zwei
Golden Globes nominiert." |
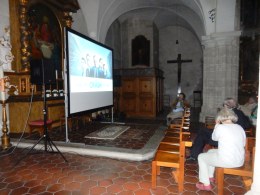 |
 |
|
nach
oben |
(Text: wr, Fotos:gm) |
|
|
13. September
2015
Künstlergespräch mit
Michael Kos


 |
|
Künstlergespräch mit
Michael Kos |
|
 Das
Gespräch mit Michael Kos im Karner gestaltete sich sehr locker und
entspannt. Nach einer kurzen Einführung über seinen künstlerischen
Werdegang und die unterschiedlichen Medien, die er als Ausdrucksform
anwendet, kam Kos schnell auf die Installation im Karner zu sprechen
und dies blieb auch Hauptthema der sich entfaltenden Diskussion mit
den Zuhörern. Es wurde von unterschiedlichen Assoziationen berichtet,
welche z.B. die Christusfigur auf der Slackline hervorruft. Auf die
Frage, was denn nun die eigentliche Intention der Installation sei,
ließ Kos durchblicken, dass er sich selbst nie ganz festlege, denn das
würde seine Gestaltung zu sehr einengen und begrenzen. Dem Betrachter
solle ein großes Spektrum an Interpretationsmöglichkeiten bleiben,
ohne dass vom Künstler alles vorgedacht worden wäre. Das
Gespräch mit Michael Kos im Karner gestaltete sich sehr locker und
entspannt. Nach einer kurzen Einführung über seinen künstlerischen
Werdegang und die unterschiedlichen Medien, die er als Ausdrucksform
anwendet, kam Kos schnell auf die Installation im Karner zu sprechen
und dies blieb auch Hauptthema der sich entfaltenden Diskussion mit
den Zuhörern. Es wurde von unterschiedlichen Assoziationen berichtet,
welche z.B. die Christusfigur auf der Slackline hervorruft. Auf die
Frage, was denn nun die eigentliche Intention der Installation sei,
ließ Kos durchblicken, dass er sich selbst nie ganz festlege, denn das
würde seine Gestaltung zu sehr einengen und begrenzen. Dem Betrachter
solle ein großes Spektrum an Interpretationsmöglichkeiten bleiben,
ohne dass vom Künstler alles vorgedacht worden wäre. |
|
 Wie
man als Bildhauer, der ursprünglich mit Holz und Stein gearbeitet hat,
überhaupt zu Installationen oder Aktionen im öffentlichen Raum komme,
beantwortete Kos einfach: wenn die direkte Reaktion und Interaktion
mit dem Publikum entscheidend für den Künstler wird, muss er sozusagen
selbst in Kontakt mit dem Publikum treten und nicht nur über seine
Kunstwerke. Das kann durch akut auftretende Themen passieren oder auch
durch Fragestellungen, die den Künstler bereits längere Zeit
beschäftigen. Das Thema der Transsubstanz z.B. hat ihn seit seiner
Kindheit beschäftigt, da die Wandlung bei der Eucharistiefeier in der
Katholischen Liturgie immer Fragen für ihn offen ließ. Dieses Thema
wird auch bei der Ausstellung im Karner aufgegriffen und z.B. durch
die farbige Übereinstimmung von geschnitztem
Corpus und bedruckten Oblaten ausgedrückt. Ist das genug Anspielung
auf die Austauschbarkeit oder gehört hier noch mehr Wie
man als Bildhauer, der ursprünglich mit Holz und Stein gearbeitet hat,
überhaupt zu Installationen oder Aktionen im öffentlichen Raum komme,
beantwortete Kos einfach: wenn die direkte Reaktion und Interaktion
mit dem Publikum entscheidend für den Künstler wird, muss er sozusagen
selbst in Kontakt mit dem Publikum treten und nicht nur über seine
Kunstwerke. Das kann durch akut auftretende Themen passieren oder auch
durch Fragestellungen, die den Künstler bereits längere Zeit
beschäftigen. Das Thema der Transsubstanz z.B. hat ihn seit seiner
Kindheit beschäftigt, da die Wandlung bei der Eucharistiefeier in der
Katholischen Liturgie immer Fragen für ihn offen ließ. Dieses Thema
wird auch bei der Ausstellung im Karner aufgegriffen und z.B. durch
die farbige Übereinstimmung von geschnitztem
Corpus und bedruckten Oblaten ausgedrückt. Ist das genug Anspielung
auf die Austauschbarkeit oder gehört hier noch mehr
 Hintergrundwissen
dazu? Diese Frage stellte sich, nachdem klar wurde, dass viele
Betrachter der Installation sehr gelassen mit der eigentlich auch
blasphemisch zu verstehenden Assoziation umzugehen scheinen. Überhaupt
scheint die breite christlich-kulturelle Tradition in unserer
Gesellschaft vehement von Generation zu Generation immer mehr verloren
zu gehen, sodass früher eindeutig verständliche Anspielungen heute oft
ins Leere gehen. Hintergrundwissen
dazu? Diese Frage stellte sich, nachdem klar wurde, dass viele
Betrachter der Installation sehr gelassen mit der eigentlich auch
blasphemisch zu verstehenden Assoziation umzugehen scheinen. Überhaupt
scheint die breite christlich-kulturelle Tradition in unserer
Gesellschaft vehement von Generation zu Generation immer mehr verloren
zu gehen, sodass früher eindeutig verständliche Anspielungen heute oft
ins Leere gehen.
Auf die Frage, welche Medien vielleicht in Zukunft für ihn interessant
werden könnten, meinte Kos, dass sicher noch nicht alles ausgereizt
sei und noch einige Überraschungen auf ihn selbst und das Publikum
zukommen werden. |
 |
 |
 |
 |
|
nach
oben |
(Text: dr, Fotos:gm) |
|
|
18. September
2015
„Der Weg in die Krise: Lassen Sie Ihr Geld arbeiten!“
Stephan Schulmeister

Begrüßung durch Pfarrer Klaus Heine



Stephan Schulmeister

Stephan Schulmeister war Gastprofessor bzw. Visiting Scholar an mehreren internationalen
Instituten, wie zum Beispiel der New York University und der
University of New Hampshire.
Schulmeister übt in seinen zahlreichen Publikationen unter
anderem eine dezidierte Kritik am Neoliberalismus (den er als
„Marktreligiosität“ bezeichnet) und fordert
Alternativvorschläge wie einen gesamteuropäischen New Deal.
Quelle: Wikipedia |
|
|
„Der Weg in die Krise: Lassen Sie Ihr Geld arbeiten!“ |
Nach einer Besichtigung der Installation im Karner
durch Dr. Stephan Schulmeister und das zahlreich erschienene
Publikum, fand die eigentliche Veranstaltung in der
Wochentagskapelle der gleich gegenüberliegenden St. Othmarskirche
statt, da durch die Installation im Karner nicht ausreichend Platz
war. Dr. Klaus Heine begrüßte den Vortragenden und stellte die
beeindruckend lange Liste der Publikationen und Vorträge an den
Beginn. Stephan Schulmeister, der manchen als Vordenker und anderen
als „schwarzes Schaf“ der österreichischen Ökonomenszene gilt, ging
gleich zum Kernpunkt seines Vortragsthemas über, den Beginn der nun
schon relativ lange anhaltenden weltweiten Wirtschaftskrise. Er
verortete diesen Zeitpunkt in das Jahr 1971 mit der Entkoppelung des
fixen Wechselkurses des US Dollars und der anderen Leitwährungen.
Bis dahin war ein stetiges Wirtschaftswachstum und mehr oder minder
Vollbeschäftigung in Europa selbst unter Berücksichtigung der
schwächeren Regionen zu verzeichnen. Auf Grund der sehr starken
Gewerkschaften kam es damals allerdings nicht zu den rückblickend
notwendig gewesenen Investitionen in z.B. umweltverträgliche
Technologien. Anhand einiger Grafiken erklärte Schulmeister in
anschaulicher Weise den Zusammenhang dieses Ereignisses mit den
darauffolgenden wirtschaftlichen Entwicklungen: durch den
zunehmenden Kursverlust des Dollars kam es zu Währungsspekulationen
und erhöhten Spekulationen auf dem Rohstoffsektor und nach und nach
zu einer Verschiebung der Investitionen von der Realwirtschaft hin
zur reinen Finanzwirtschaft, da in den zunehmend kurzfristigeren
Börsenspekulationen eine weitaus größere Gewinnspanne zu
erwirtschaften war als durch Investitionen in der Realwirtschaft.
Damit verschob sich das ursprüngliche Gleichgewicht aus real
erwirtschafteten Gewinnen und Aktienkursen immer mehr ins Fiktive
und es kam zu massiven Überbewertungen von Derivaten und Hedgefonds,
die nur auf Kursschwankungsspekulationen beruhen. Die bekannten
Crashs von 2008 und andere Krisen sind somit Ausdruck des immer
weiteren Auseinanderdriftens von realen Wirtschaftsleistungen und
Börsenbewertungen. Der heute oft nur mehr computergesteuerte
Börsehandel mit An- und Verkauf innerhalb von Nanosekunden reagiert
auf die kleinsten Verschiebungen und verstärkt somit Auf- oder
Abwärtsbewegungen der Kurse sofort und massiv. Als Folge der
Kursverfälle kam es in Europa zu massiver Sparpolitik, die aber
weitere Investitionen in der Realwirtschaft immer mehr unterdrückt
und zu steigender Arbeitslosigkeit bzw. Lohndumping führt,
interessanterweise ohne nennenswerte Gegenwehr der Gewerkschaften,
wie das immer in Krisenzeiten zu verzeichnen ist.
Als Lösung schlägt Schulmeister eine Abkehr von dieser Sparpolitik
und eine Art New Deal für Europa vor, d.h. Investitionen und
Beschäftigungsprogramme wie unter Roosevelt in der
Zwischenkriegszeit in den USA, der sich unabhängig von der Meinung
der meisten Ökonomen eher auf seinen Hausverstand verließ und den
Menschen Hoffnung auf einen Wirtschaftsaufschwung gab, der in der
Folge auch eintrat. Schulmeister fordert generell eine Abkoppelung
vom Diktat des freien Marktes, der jede freie Entscheidung scheinbar
von vornherein unmöglich macht, da „ der Markt alles regelt“ und
eine unkomplizierte Herangehensweise und Reaktion auf die jeweils
akuten Probleme.
Die anschließende Diskussion war sehr intensiv und ausführlich und
führte auch zu Anfragen bezüglich der momentanen
Flüchtlingsproblematik und deren wirtschaftlichen Auswirkungen. |




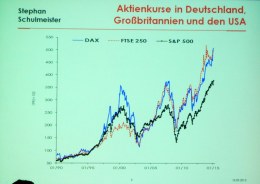
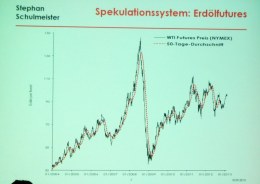
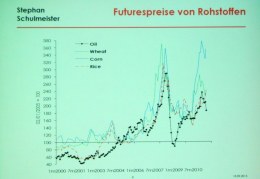
 |
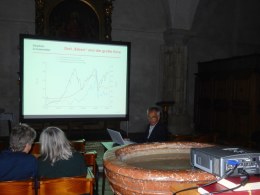 |
 |
|
nach
oben |
(Text: Fotos: gm) |
|
|
20. September 2015
Texte zum Nachdenken:
„Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon“
Pfarrer Richard Posch & Klaus Heine






Lk 16, 1-13
Das Gleichnis
vom klugen Verwalter
1 Jesus sagte zu den Jüngern: Ein reicher Mann hatte einen Verwalter.
Diesen beschuldigte man bei ihm, er verschleudere sein Vermögen.
2 Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm: Was höre ich über dich?
Leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung! Du kannst nicht länger mein
Verwalter sein.
3 Da überlegte der Verwalter: Mein Herr entzieht mir die Verwaltung.
Was soll ich jetzt tun? Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht, und zu
betteln schäme ich mich.
4 Doch - ich weiß, was ich tun muss, damit mich die Leute in ihre
Häuser aufnehmen, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin.
5 Und er ließ die Schuldner seines Herrn, einen nach dem andern, zu
sich kommen und fragte den ersten: Wie viel bist du meinem Herrn
schuldig?
6 Er antwortete: Hundert Fass Öl. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen
Schuldschein, setz dich gleich hin und schreib «fünfzig».1
7 Dann fragte er einen andern: Wie viel bist du schuldig? Der
antwortete: Hundert Sack Weizen. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen
Schuldschein und schreib «achtzig».2
8 Und der Herr lobte die Klugheit des unehrlichen Verwalters und
sagte: Die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger
als die Kinder des Lichtes. |
|

|
Mt 25, 14-30
Das Gleichnis vom anvertrauten Geld
14 Es ist wie mit einem Mann, der auf Reisen ging: Er rief seine
Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an.
15 Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei,
wieder einem anderen eines, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste
er ab. Sofort1
16 begann der Diener, der fünf Talente erhalten hatte, mit ihnen zu
wirtschaften, und er gewann noch fünf dazu.
17 Ebenso gewann der, der zwei erhalten hatte, noch zwei dazu.
18 Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein
Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn.
19 Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, um von den Dienern
Rechenschaft zu verlangen.
20 Da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte, brachte fünf
weitere und sagte: Herr, fünf Talente hast du mir gegeben; sieh her,
ich habe noch fünf dazu gewonnen.
21 Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer
Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen, ich will dir
eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines
Herrn!
22 Dann kam der Diener, der zwei Talente erhalten hatte, und sagte:
Herr, du hast mir zwei Talente gegeben; sieh her, ich habe noch zwei
dazu gewonnen.
23 Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer
Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen, ich will dir
eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines
Herrn!
24 Zuletzt kam auch der Diener, der das eine Talent erhalten hatte,
und sagte: Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist; du
erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut
hast;
25 weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt.
Hier hast du es wieder.
26 Sein Herr antwortete ihm: Du bist ein schlechter und fauler Diener!
Du hast doch gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und
sammle, wo ich nicht ausgestreut habe.
27 Hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank gebracht, dann hätte
ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten.
28 Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn
Talente hat!
29 Denn wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluss haben; wer
aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat.
30 Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis!
Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. |
Pfarrer Richard Posch
& Pfarrer i.R. Klaus Heine

|
|
Texte zum
Nachdenken: „Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon“ |
|
 Wie
bei jeder Ausstellung bei KUNST IM KARNER wird das Kunstwerk als
Impulsgeber für verschiedene Veranstaltungen im Rahmenprogramm
genutzt. Jedes Mal ist auch ein spiritueller Abend dabei. Die
Installation von Michael Kos rückt das Thema Balance stark in
Richtung wirtschaftliches und soziales Gleichgewicht und den Umgang
der Christen mit diesen Fragen. Klaus Heine und Richard Posch
behandelten mit ausgewählten Stellen des Neuen Testaments die
Stellung Jesu zum Thema „Geld“ und versuchten eine klare Linie und
damit „Anleitung“ zum richtigen Umgang damit herauszufiltern. Es
zeigte sich, dass trotz Jahrhunderte langer Exegese immer noch
Fragen der Auslegung offen bleiben wie z.B. im
Lukas-Evangelium unterschiedliche
Auslegungen möglich sind. Aufgelockert wurden die teils sehr
nachdenklich stimmenden Texte durch bekannte Musikstücke, die alle
im Titel „money“ beinhalten. Wie
bei jeder Ausstellung bei KUNST IM KARNER wird das Kunstwerk als
Impulsgeber für verschiedene Veranstaltungen im Rahmenprogramm
genutzt. Jedes Mal ist auch ein spiritueller Abend dabei. Die
Installation von Michael Kos rückt das Thema Balance stark in
Richtung wirtschaftliches und soziales Gleichgewicht und den Umgang
der Christen mit diesen Fragen. Klaus Heine und Richard Posch
behandelten mit ausgewählten Stellen des Neuen Testaments die
Stellung Jesu zum Thema „Geld“ und versuchten eine klare Linie und
damit „Anleitung“ zum richtigen Umgang damit herauszufiltern. Es
zeigte sich, dass trotz Jahrhunderte langer Exegese immer noch
Fragen der Auslegung offen bleiben wie z.B. im
Lukas-Evangelium unterschiedliche
Auslegungen möglich sind. Aufgelockert wurden die teils sehr
nachdenklich stimmenden Texte durch bekannte Musikstücke, die alle
im Titel „money“ beinhalten. |
|
Pfarrer i.R.
Klaus Heine: Geld oder Gott |
|
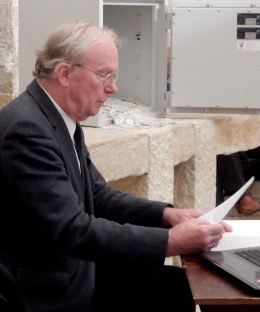 Unter
diesem Titel hat der frühere Wiener systematische Theologe Falk
Wagner schon 1985 eine Untersuchung „zur Geldbestimmtheit der
kulturellen und religiösen Lebenswelt“ vorgelegt. Er schreibt im
Vorwort: „Gott – das Absolute – ist zu jeder Zeit gegenwärtig: es
fragt sich nur in welcher Gestalt. Unter den Bedingungen der
modernen, ökonomisch bestimmten Gesellschaft tritt das Geld seine
Karriere als alles bestimmende Wirklichkeit an. Damit löst es die
Funktion des Gottesgedankens in der Gestalt eines Geld-Pantheismus
ab…“ Die weitgehende Verdrängung dieser Realität in der Theologie
ändert nichts an der Tatsache: „Der Pantheismus des Geldes hält dann
auch dort Einzug, wo man sich zugute hält, zwischen Gott und Abgott,
Gott und Welt, Religion und Aberglaube unterscheiden zu können.“ Unter
diesem Titel hat der frühere Wiener systematische Theologe Falk
Wagner schon 1985 eine Untersuchung „zur Geldbestimmtheit der
kulturellen und religiösen Lebenswelt“ vorgelegt. Er schreibt im
Vorwort: „Gott – das Absolute – ist zu jeder Zeit gegenwärtig: es
fragt sich nur in welcher Gestalt. Unter den Bedingungen der
modernen, ökonomisch bestimmten Gesellschaft tritt das Geld seine
Karriere als alles bestimmende Wirklichkeit an. Damit löst es die
Funktion des Gottesgedankens in der Gestalt eines Geld-Pantheismus
ab…“ Die weitgehende Verdrängung dieser Realität in der Theologie
ändert nichts an der Tatsache: „Der Pantheismus des Geldes hält dann
auch dort Einzug, wo man sich zugute hält, zwischen Gott und Abgott,
Gott und Welt, Religion und Aberglaube unterscheiden zu können.“
Wagner bringt damit auf den Begriff, was das Sprichwort „Geld
regiert die Welt“ feststellt, und in Goethes „Faust“ Gretchen beim
Betrachten des Schmuckes, den ihr Mephistopheles (!) in die Kammer
gebracht hat, resignierend bemerkt: „Nach Golde drängt, am Golde
hängt doch alles. Ach, wir Armen!“ Wie kommt es zu dieser
Entwicklung, dass das Geld zur alles bestimmenden Macht wird und
geradezu göttlichen Charakter gewinnt? Es ist doch eigentlich ein
praktisches Tauschmittel für das wirtschaftliche, gesellschaftliche
und kulturelle Leben. Ob Muscheln, Silber oder Gold – wertvolle
symbolische Mittel heben den primitiven Tauschhandel auf ein höheres
Niveau, ermöglichen größere und differenziertere gesellschaftliche
Strukturen, können durch weitgespannten Handel Bedürfnisse
befriedigen und den allgemeinen Wohlstand erhöhen. Ein Leben in der
modernen Weltgesellschaft ohne das Medium Geld erscheint
unvorstellbar. Nur in katastrophalen Kriegs-
oder Nachkriegszeiten kann der Rückfall in den Tauschhandel
erfolgen. Aber auch da baut sich rasch eine Ersatzwährung auf, wenn
wir etwa an die „Zigarettenwährung“ im Schwarzhandel nach dem
Zweiten Weltkrieg denken. So notwendig und praktisch das
Tauschmittel Geld aber auch sein mag, neutral scheint es von Anfang
an nicht zu sein. Jesus warnt in der Bergpredigt vor dem Streben
nach Reichtum und berührt damit lange vor dem modernen Kapitalismus
den wunden Punkt: „Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden,
wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen
und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder
Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und
stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz….Niemand
kann zwei Herren dienen: entweder er wird den einen hassen und den
anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen
verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.“ Diese harte
und klare Alternative gilt auch in der unvergleichlich viel mehr von
der Geldwirtschaft bestimmten modernen Welt. Mit Geld kann ich nicht
nur Dinge und Leistungen kaufen, sondern auch Macht ausüben,
Menschen lenken, und glaube am Ende, alles sei mit Geld machbar.
Manche vergessen dabei, dass etwa der Ausdruck „käufliche Liebe“ ein
Widerspruch in sich selbst ist. Jesus tadelt im Gleichnis die
Dummheit des Bauern, der eine reiche Ernte horten will und doch
gegen seinen Tod nichts ausrichten kann. Er lobt einen Verwalter,
der sich in moralisch anrüchiger Weise mit dem ungerechten Mammon
Freunde macht, indem er auf Kosten seines Herrn Schulden erlässt.
 Eine
strukturelle Ähnlichkeit von Sakrament und Geld weist auf die
Verführungskraft des Letzteren und die befreiende Kraft des Ersteren
hin: Beim Hl. bendmahl nehmen wir ein Stück
Brot bzw. die Hostie und einen Schluck Wein
zu uns. Das sind bescheidene irdische Dinge. Sie gewinnen aber einen
ganz besonderen Wert durch die Worte Jesu: Dies ist mein Leib, dies
ist mein Blut! Und unseren Glauben daran, dass Christus in der Feier
so real präsent bei uns ist mit all seiner vergebenden und heilenden
Kraft, wie wir sinnlich Brot und Wein zu uns nehmen. Dies
Gedächtnismahl bildet die Verleiblichung des Gottesgeistes immer neu
ab und drängt als kultisches Symbol in das alltägliche reale Leben
der Gemeinde. Wo dieser Fluss nicht erfolgt, verliert das Sakrament
seine Kraft. Eine
strukturelle Ähnlichkeit von Sakrament und Geld weist auf die
Verführungskraft des Letzteren und die befreiende Kraft des Ersteren
hin: Beim Hl. bendmahl nehmen wir ein Stück
Brot bzw. die Hostie und einen Schluck Wein
zu uns. Das sind bescheidene irdische Dinge. Sie gewinnen aber einen
ganz besonderen Wert durch die Worte Jesu: Dies ist mein Leib, dies
ist mein Blut! Und unseren Glauben daran, dass Christus in der Feier
so real präsent bei uns ist mit all seiner vergebenden und heilenden
Kraft, wie wir sinnlich Brot und Wein zu uns nehmen. Dies
Gedächtnismahl bildet die Verleiblichung des Gottesgeistes immer neu
ab und drängt als kultisches Symbol in das alltägliche reale Leben
der Gemeinde. Wo dieser Fluss nicht erfolgt, verliert das Sakrament
seine Kraft.
Auch der Sachwert einer heutigen Geldmünze oder einer Banknote ist
minimal. Aber die Ziffernaufschrift und die Garantie der zentralen
Bankbehörde und das Vertrauen der Bevölkerung verleihen diesem Geld
seinen Wert. Es ist schon faszinierend, wie reale Werte, Häuser,
Grundstücke, Autos, Dienstleistungen auf einen Stapel Papierscheine
abstrahiert, ja im modernen Geldverkehr auf einige elektronische
Impulse „vergeistigt“ werden können. Der Endpunkt dieser Entwicklung
wäre erreicht, wenn Münzen und Banknoten überhaupt abgeschafft
würden, wie es einige Ökonomen wünschen. Aber Gott Mammon wird ich
sein „Sakrament“ nicht nehmen lassen.
Die Verführungskraft dieser Abstraktion liegt darin, dass ich diese
Vergeistigung wieder rückgängig machen und mir mit einem Haufen Geld
eine ganze Welt erschaffen kann. Ist es ein Wunder, dass da die
menschliche Gier erwacht? Dass man nicht nur der Armut und
existentieller Not entfliehen, sondern über immer unbegrenztere
Macht verfügen möchte? Bliebe es beim Geld als bloßem Tauschmittel,
um die Lebensbedürfnisse der Menschen in ausgleichender
Gerechtigkeit befriedigen zu helfen, könnte man mit ihm viel Gutes
tun. Aber das Horten auf Kosten anderer, diese Verführung „Lassen
Sie Ihr Geld arbeiten!“ treibt in die Herrschaft des Gottes Mammon
und das Nachäffen der Schöpferkraft des dreieinigen Gottes. Es sind
zwar nicht mehr Motten und Rost, die die Schätze angreifen, es sind
Inflation und hochkomplizierte, oft kriminelle Bankgeschäfte die
unsere Ersparnisse anknabbern, aber Jesu Warnung vor der
Akkumulation von Kapital besteht nach wie vor. Sein Sakrament kann
man essen, und es führt in ein Leben liebevoller Gemeinschaft, in
der für Leib und Seele gesorgt wird. Geld kann man nicht essen, und
wer es als Mittel zu einsamer Machterweiterung nutzt, verschreibt
sich den Gesetzen Mammons. So wird er am Ende nicht die Freiheit
gewinnen, sondern zum Sklaven. |
|
Pfarrer Richard Posch zum Gleichnis vom
klugen Verwalter (Lk 16, 1-13) |
 Die
Geschichte, die Jesus hier erzählt ist als Gegenstück zur Erzählung
vom dummen Reichen zu erkennen. Die von der Hauptfigur geplanten
Handlungen führen im Fall des reichen Kornbauern dazu, dass Gott ihn
als „Narr“ bezeichnet, während die Handlungen des unehrlichen
Verwalters diesem das Lob eintragen, „Klug“ gehandelt zu haben.
Diese Antithese wird dadurch profiliert, dass der dumme Bauer seine
Situation falsch einschätzt, während der Verwalter aus der Lage, in
der er sich befindet, die richtigen Konsequenzen zieht und alles
tut, damit der „bei Gott reich ist“. Die Erzählung endet offen:
Weder wird erzählt, wie der reiche Mann auf die Aktion seines
Verwalters reagiert, noch, ob sie erfolgreich war und er nach seiner
Entlassung von den Schuldnern seines Herrn auch tatsächlich
aufgenommen wird. Innerhalb des zeitlichen Ablaufs der Erzählung
werden die Hörer genau in die Situation gestellt, in der der
entlassene Verwalter den inneren Monolog spricht und sich fragt, was
er tun soll. Die
Geschichte, die Jesus hier erzählt ist als Gegenstück zur Erzählung
vom dummen Reichen zu erkennen. Die von der Hauptfigur geplanten
Handlungen führen im Fall des reichen Kornbauern dazu, dass Gott ihn
als „Narr“ bezeichnet, während die Handlungen des unehrlichen
Verwalters diesem das Lob eintragen, „Klug“ gehandelt zu haben.
Diese Antithese wird dadurch profiliert, dass der dumme Bauer seine
Situation falsch einschätzt, während der Verwalter aus der Lage, in
der er sich befindet, die richtigen Konsequenzen zieht und alles
tut, damit der „bei Gott reich ist“. Die Erzählung endet offen:
Weder wird erzählt, wie der reiche Mann auf die Aktion seines
Verwalters reagiert, noch, ob sie erfolgreich war und er nach seiner
Entlassung von den Schuldnern seines Herrn auch tatsächlich
aufgenommen wird. Innerhalb des zeitlichen Ablaufs der Erzählung
werden die Hörer genau in die Situation gestellt, in der der
entlassene Verwalter den inneren Monolog spricht und sich fragt, was
er tun soll.
Obwohl nicht ausdrücklich gefragt wird, ob die gegen den
Verwaltererhobenen Anschuldigungen zutreffen oder nicht, setzt der
Fortgang der Erzählung voraus, dass der Verwalter davon ausgeht, die
Anschuldigungen nicht abwehren zu können. Es ist von „verschwenden“
die Rede und nicht von Unterschlagung. Der Verwalter wird darum auch
nur entlassen und nicht bestraft.
Die Parabel von einem besonders klugen Verwalter, der alles auf eine
Karte setzt, scheint schon früh schwer verständlich gewesen zu sein.
Deshalb finden wir im Lukasevangelium eine ganze Reihe von
(verschiedenen!) Anwendungen, welche die Christen insgesamt und
deren Umgang mit Gütern und mit Reichtum im Blick haben. Das
Verhalten des Verwalters wird zunächst als positiv und dann als
negativ hingestellt:
 1.
Deutung: positive Identifikationsfigur (V. 8a): Erst mit dieser
Auslegung der Parabel wird der Verwalter als „unehrlich“
hingestellt. Seine Klugheit, d.h. sein zielbewusstes Handeln, wird
aber vom Herrn gelobt. Der Herr ist hier nicht mehr der reiche Mann
von Vers 3, sondern der auferstandene Herr der Kirche. Insgesamt ist
Vers 8 als eine spätere Regieanweisung für den Erzähler der Parabel
zu sehen. 1.
Deutung: positive Identifikationsfigur (V. 8a): Erst mit dieser
Auslegung der Parabel wird der Verwalter als „unehrlich“
hingestellt. Seine Klugheit, d.h. sein zielbewusstes Handeln, wird
aber vom Herrn gelobt. Der Herr ist hier nicht mehr der reiche Mann
von Vers 3, sondern der auferstandene Herr der Kirche. Insgesamt ist
Vers 8 als eine spätere Regieanweisung für den Erzähler der Parabel
zu sehen.
2. Deutung: positive Identifikationsfigur (V. 8b): Nahtlos wird eine
zweite Auslegung angefügt. Die Jünger („Kinder des Lichts“) werden
darin aufgefordert, sich am Verwalter ein Beispiel zu nehmen. Mit
beiden Deutungen werden die Zuhörer zum Überdenken ihres
(christlichen) Handelns aufgefordert.
3. Deutung: positive Identifikationsfigur (V. 9): In dieser und den
folgenden Deutungen wird das Augenmerk nun nicht mehr auf den
Verwalter, sondern auf den Umgang mit dem Mammon gelegt. „Mammon“
ist ein aramäischer Ausdruck für unredlichen Erwerb und trügerisches
Gewinnstreben. In Vers 9 wird eigentlich nur Vers 4 der Parabel
aufgegriffen und zum eigenen Lebensende in Beziehung gesetzt.
Vermögen wird ausdrücklich als negativ („Mammon der
Ungerechtigkeit“) beurteilt. Das Geben von (individuellen) Almosen
ist eine Grundvoraussetzung, um im Gericht bestehen zu können.
4. Deutung: abschreckendes Beispiel (VV. 10-12): Konträr zu den
bisherigen Auslegungen wird der Verwalter jetzt als Negativfolie
benutzt. Christen sollen nicht so handeln wie der Verwalter.
Zuverlässiges Handeln (in der Gemeinde der Christen) ist die
Voraussetzung zum Erlangen des „Lohnes im Himmel“.
 5.
Deutung: abschließendes Resümee (V. 13): In den bisherigen Deutungen
ging es um die Frage, wie sich ein Christ zum Besitz verhalten soll.
In diesem zusammenfassenden Vers wird aber der Besitz insgesamt Gott
gegenübergestellt und damit als negativ beurteilt. 5.
Deutung: abschließendes Resümee (V. 13): In den bisherigen Deutungen
ging es um die Frage, wie sich ein Christ zum Besitz verhalten soll.
In diesem zusammenfassenden Vers wird aber der Besitz insgesamt Gott
gegenübergestellt und damit als negativ beurteilt.
Wenn wir von der Voraussetzung ausgehen dass „der Herr“ in Vers 8
mit Jesus Christus gleichzusetzen ist, der den Verwalter für sein
Handeln zunächst lobt, merken wir, dass er sich gleichzeitig von
dieser Handlungsweise distanziert. Er stellt die betrügerische
Handlungsweise des Verwalters als typisch für diejenigen Menschen
dar, die nicht zur Gruppe der intendierten Leser gehören, denn bei
ihnen setzt er höhere ethische Standards als selbstverständlich
voraus: das kommt zum Ausdruck in der Gegenüberstellung der „Kinder
dieser Welt“ mit den „Kindern des Lichts“. Daher können wir die
Parabel nicht als eine Aufforderung zum Betrug missverstehen. Der
Verwalter wird zu einem Beispiel dafür, wie man aus Geld und Gut
einen wirklich nachhaltigen und krisensichern Nutzen ziehen kann:
indem man es Anderen zugutekommen lässt und sich dadurch Freunde
macht. Aber weil der Verwalter auf den Besitz seines Arbeitgebers
zurückgegriffen hat, war er gerade nicht treu, und diesen Aspekt des
Handelns sollen sich die Leser nicht zum Vorbild nehmen. |
|
Pfarrer Richard Posch
zum Gleichnis vom anvertrauten Geld
(Mt 25, 14-30) |
 Betrachten
wir zunächst den Erzählverlauf. Ein Mann, der am besten als
Großkaufmann vorzustellen ist, verreist, vermutlich ins Ausland. Er
überträgt dreien seiner Sklaven sein Vermögen, ohne ihnen einen
besonderen Auftrag zu hinterlassen. Das bedeutet, dass er die Art
und Weise, wie sie mit dem Vermögen umgehen, ihnen überlässt. Ein
Sklave konnte ein ihm von seinem Herrn übergebenes Gels nutzbringend
verwenden. Er war dann in dieser Sache wie sein Herr. Nur gehörte
der erzielte Gewinn natürlich nicht ihm, sondern seinem Herrn. Den
Sklaven werden beträchtliche Geldsummen hinterlassen, aber nicht
jeder erhält den gleichen Betrag. Der Herr kennt seine Sklaven und
weiß ihre Tüchtigkeit zu einzuschätzen. 5 Talente sind 30000 Denare
(ein Denar ein Tageslohn), 2 und 1 Talent also 12000 und 6000 Denare
Sofort nach der Abreise des Herrn macht sich der erste an die
Arbeit. Er gewinnt die gleiche unglaubliche Summe hinzu: wie, wird
nicht gesagt. Man kann davon ausgehen, dass es vorwiegend durch
Anlage bei der Bank geschah. Bankhalter im alten Israel hatten im
wesentlichen drei Aufgaben zu erfüllen: Geld zu wechseln, Geld
aufzubewahren (ohne Zins) , mit übertragenem Geld Zinsen zu
erwirtschaften. Dieser Fall des offenen Depositum ist für unser
Gleichnis anzunehmen. Bankhalter und Geldgeber teilten sich den
Gewinn. Die Zinsen kamen zwar von selbst, doch sind für den Gewinn
eines hohen Betrages die ständige Überwachung des Geldes und wohl
auch noch andere geschäftliche Unternehmungen erforderlich. Der
zweite Sklave arbeitet ebenso erfolgreich. Der dritte aber vergräbt
seine 6000 Denare in der Erde. So verfuhr man immer in Kriesgszeiten,
wenn flüssiger Besitz dem Zugriff des Feindes ausgeliefert war. Der
dritte Sklave wählt offenbar einen ihm sicher erscheinenden Weg. Wer
ein Depositum vergrub, war nach rabbinischem Recht im Fall des
Diebstahls von der Haftpflicht befreit. Der nach langer Zeit
zurückkehrende Herr hält Abrechnung mit den drei Sklaven. Die beiden
Erfolgreichen weisen ihre Gewinne vor. Immerhin erhält der Herr von
ihnen 14 Talente zurück. Seine Belohnung begründet er mit ihrer
Zuverlässigkeit und Treue. Es stimmt mit rabbinischer Auffassung
überein, dass Zuverlässigkeit im Kleinen den Menschen bei Gott groß
macht. Sie dürfen eine führende Position im Unternehmen des Herrn
empfangen. Die Aufforderung, in die Freude des Herrn einzutreten,
macht die Szene transparent im Hinblick auf das messianische
Freudenmahl im Reich Gottes. Der dritte wähnte offensichtlich genug
getan zu haben. Im fehlte der Mut zum Einsatz. Zur Bestrafung wird
er des ihm anvertrauten Talents beraubt. Er sinkt wieder zurück in
die Bedeutungslosigkeit. Mt will die „Zwischenzeit“, die Zeit
unserer Lebensspanne vor dem Ankunft des Herrn zur selbständigen
Größe erheben. Man darf die Hände nicht in den Schoß leben oder mit
dem anvertrauten Gut verantwortungslos umgehen. Die Verantwortung in
der Welt, die der Gemeinde übertragen ist, wird hier ins Bewusstsein
gerufen. Die Differenzierung der Verantwortung aber dürfte er als
Hinweis auf unterschiedliche Bedeutung von Gemeindemitgliedern für
das Gelingen des Gemeindelebens und die Realisierung der
Verantwortung der Christen aufgefasst haben. Aber niemand ist
dispensiert. Das Risiko, der Einsatz muss gewagt werden.
Zwischenzeit ist auch die Zeit für das verantwortete Risiko, wie es
das Geldgeschäft veranschaulicht. Das überantwortete Gut ist
Geschenk. Wer ungeteilt Jesus nachfolgt, wer sein Wort hört und tut,
kann darauf bauen, dass die Gabe ihn trägt. Betrachten
wir zunächst den Erzählverlauf. Ein Mann, der am besten als
Großkaufmann vorzustellen ist, verreist, vermutlich ins Ausland. Er
überträgt dreien seiner Sklaven sein Vermögen, ohne ihnen einen
besonderen Auftrag zu hinterlassen. Das bedeutet, dass er die Art
und Weise, wie sie mit dem Vermögen umgehen, ihnen überlässt. Ein
Sklave konnte ein ihm von seinem Herrn übergebenes Gels nutzbringend
verwenden. Er war dann in dieser Sache wie sein Herr. Nur gehörte
der erzielte Gewinn natürlich nicht ihm, sondern seinem Herrn. Den
Sklaven werden beträchtliche Geldsummen hinterlassen, aber nicht
jeder erhält den gleichen Betrag. Der Herr kennt seine Sklaven und
weiß ihre Tüchtigkeit zu einzuschätzen. 5 Talente sind 30000 Denare
(ein Denar ein Tageslohn), 2 und 1 Talent also 12000 und 6000 Denare
Sofort nach der Abreise des Herrn macht sich der erste an die
Arbeit. Er gewinnt die gleiche unglaubliche Summe hinzu: wie, wird
nicht gesagt. Man kann davon ausgehen, dass es vorwiegend durch
Anlage bei der Bank geschah. Bankhalter im alten Israel hatten im
wesentlichen drei Aufgaben zu erfüllen: Geld zu wechseln, Geld
aufzubewahren (ohne Zins) , mit übertragenem Geld Zinsen zu
erwirtschaften. Dieser Fall des offenen Depositum ist für unser
Gleichnis anzunehmen. Bankhalter und Geldgeber teilten sich den
Gewinn. Die Zinsen kamen zwar von selbst, doch sind für den Gewinn
eines hohen Betrages die ständige Überwachung des Geldes und wohl
auch noch andere geschäftliche Unternehmungen erforderlich. Der
zweite Sklave arbeitet ebenso erfolgreich. Der dritte aber vergräbt
seine 6000 Denare in der Erde. So verfuhr man immer in Kriesgszeiten,
wenn flüssiger Besitz dem Zugriff des Feindes ausgeliefert war. Der
dritte Sklave wählt offenbar einen ihm sicher erscheinenden Weg. Wer
ein Depositum vergrub, war nach rabbinischem Recht im Fall des
Diebstahls von der Haftpflicht befreit. Der nach langer Zeit
zurückkehrende Herr hält Abrechnung mit den drei Sklaven. Die beiden
Erfolgreichen weisen ihre Gewinne vor. Immerhin erhält der Herr von
ihnen 14 Talente zurück. Seine Belohnung begründet er mit ihrer
Zuverlässigkeit und Treue. Es stimmt mit rabbinischer Auffassung
überein, dass Zuverlässigkeit im Kleinen den Menschen bei Gott groß
macht. Sie dürfen eine führende Position im Unternehmen des Herrn
empfangen. Die Aufforderung, in die Freude des Herrn einzutreten,
macht die Szene transparent im Hinblick auf das messianische
Freudenmahl im Reich Gottes. Der dritte wähnte offensichtlich genug
getan zu haben. Im fehlte der Mut zum Einsatz. Zur Bestrafung wird
er des ihm anvertrauten Talents beraubt. Er sinkt wieder zurück in
die Bedeutungslosigkeit. Mt will die „Zwischenzeit“, die Zeit
unserer Lebensspanne vor dem Ankunft des Herrn zur selbständigen
Größe erheben. Man darf die Hände nicht in den Schoß leben oder mit
dem anvertrauten Gut verantwortungslos umgehen. Die Verantwortung in
der Welt, die der Gemeinde übertragen ist, wird hier ins Bewusstsein
gerufen. Die Differenzierung der Verantwortung aber dürfte er als
Hinweis auf unterschiedliche Bedeutung von Gemeindemitgliedern für
das Gelingen des Gemeindelebens und die Realisierung der
Verantwortung der Christen aufgefasst haben. Aber niemand ist
dispensiert. Das Risiko, der Einsatz muss gewagt werden.
Zwischenzeit ist auch die Zeit für das verantwortete Risiko, wie es
das Geldgeschäft veranschaulicht. Das überantwortete Gut ist
Geschenk. Wer ungeteilt Jesus nachfolgt, wer sein Wort hört und tut,
kann darauf bauen, dass die Gabe ihn trägt.
 Das
Gleichnis will aber vor allem einen Blick in das Jenseitige
eröffnen, wobei die Darstellungen des negativen Ausgangs
anschaulicher ausfallen, als die positiven. Dennoch sollte nicht
übersehen werden, wie im Gleichnis auch das Positive zum Zuge kommt:
die Freude, das Freudenfest, das Freudenmahl, zu dem der Herr lädt.
In seiner Bildrede tritt das Freudenmahl neben die Verheißungen, die
die Seligpreisungen der Bergpredigt bekommen (vgl. Mt 5,3-12). Die
Wachsamkeit steht im Vordergrund. Wachsam sein heißt, die
anvertraute begrenzte Zeit mit den Gaben füllen, die der Herr seinen
Jüngern gewährt. Diese Zeit zu verspielen ist das abschreckende
Gegenbild, das der träge und zum Risiko nicht bereite Sklave abgibt.
Man hat die Parabel als Aufforderung zu Arbeit und Treue verstanden,
die als Bedingung für den Eintritt „in die Zahl der Auserwählten“
gewertet seien. Man hat aus ihr die Warnung vor einem Weltverhältnis
herausgehört, das aus Furcht vor der Welt jedes Risiko vermeidet und
dies mit einer Warnung vor dem Unglauben gleichgestellt. Man hat die
Geschichte konkret antipharisäisch gedeutet und dabei im dritten
Sklaven pharisäisches Verhalten kritisiert gesehen, das gesetzlich
bestimmt ist und mit Gott wie mit einem Geldwechsler umgeht. Man hat
die Schriftgelehrten als die Führer des jüdischen Volkes oder das
ganze Volk Israel angesprochen sein lassen, denen mit Gottes Wort
vieles anvertraut worden sei, und dabei in der Regel den dritten
Sklaven in das Rampenlicht gerückt. Jesus erläutert mit dem
Gleichnis das Riech Gottes. Er spricht nicht von seiner Parusie
sondern von der Zeit, die jetzt noch eingeräumt und durch das Reich
Gottes – das erwartete und in seinem Wirken schon erfahrbare –
qualifiziert ist. Das Gleichnis wendet sich an alle, die auf seine
Botschaft eingehen und sich durch dieses Reich bestimmen lassen.
Steht auch das den Menschen gewährte Geschenk im Vordergrund, so ist
der mit ihm verbundene Anspruch das eigentliche Anliegen.
Entsprechung und Vergeudung, freudiger Einsatz und Das
Gleichnis will aber vor allem einen Blick in das Jenseitige
eröffnen, wobei die Darstellungen des negativen Ausgangs
anschaulicher ausfallen, als die positiven. Dennoch sollte nicht
übersehen werden, wie im Gleichnis auch das Positive zum Zuge kommt:
die Freude, das Freudenfest, das Freudenmahl, zu dem der Herr lädt.
In seiner Bildrede tritt das Freudenmahl neben die Verheißungen, die
die Seligpreisungen der Bergpredigt bekommen (vgl. Mt 5,3-12). Die
Wachsamkeit steht im Vordergrund. Wachsam sein heißt, die
anvertraute begrenzte Zeit mit den Gaben füllen, die der Herr seinen
Jüngern gewährt. Diese Zeit zu verspielen ist das abschreckende
Gegenbild, das der träge und zum Risiko nicht bereite Sklave abgibt.
Man hat die Parabel als Aufforderung zu Arbeit und Treue verstanden,
die als Bedingung für den Eintritt „in die Zahl der Auserwählten“
gewertet seien. Man hat aus ihr die Warnung vor einem Weltverhältnis
herausgehört, das aus Furcht vor der Welt jedes Risiko vermeidet und
dies mit einer Warnung vor dem Unglauben gleichgestellt. Man hat die
Geschichte konkret antipharisäisch gedeutet und dabei im dritten
Sklaven pharisäisches Verhalten kritisiert gesehen, das gesetzlich
bestimmt ist und mit Gott wie mit einem Geldwechsler umgeht. Man hat
die Schriftgelehrten als die Führer des jüdischen Volkes oder das
ganze Volk Israel angesprochen sein lassen, denen mit Gottes Wort
vieles anvertraut worden sei, und dabei in der Regel den dritten
Sklaven in das Rampenlicht gerückt. Jesus erläutert mit dem
Gleichnis das Riech Gottes. Er spricht nicht von seiner Parusie
sondern von der Zeit, die jetzt noch eingeräumt und durch das Reich
Gottes – das erwartete und in seinem Wirken schon erfahrbare –
qualifiziert ist. Das Gleichnis wendet sich an alle, die auf seine
Botschaft eingehen und sich durch dieses Reich bestimmen lassen.
Steht auch das den Menschen gewährte Geschenk im Vordergrund, so ist
der mit ihm verbundene Anspruch das eigentliche Anliegen.
Entsprechung und Vergeudung, freudiger Einsatz und
 leichtsinniges
Verspielen werden einander gegenübergestellt. Beides ist von
Bedeutung, wenngleich letzteres mit besonderer Schärfe
gekennzeichnet ist. Die Erwähnung von zwei sich bewährenden Sklaven
schöpft ihre Berechtigung aus der unterschiedlichen Gabe. Gott wirkt
in dieser Welt nicht mit Gleichmacherei, sondern berücksichtigt die
Möglichkeiten. Damit kommt keiner zu kurz. Entscheidend ist am Ende
die Annahme durch Gott, auf die jeder vertrauen kann, der sich ganz
auf das Wort Jesu einlässt und es in sein Leben umzusetzen bemüht
ist. Begünstigt die Parabel Leistungsdenken? In einem gewissen Sinne
schon, da vor allem der Sklave nicht besteht, der das Talent
begraben hat. Dabei darf das Verhältnis des Sklaven zum Herrn nicht
außer Acht gelassen werden: jeder lebt von der Gabe des Herrn. Was
er erzielt, kann nur in relativem Sinn als sein Erfolg gesehen
werden. Was von ihm erwartet wird, ist ein Beteiligt. Und
Interessiertsein. Wer sich als Jünger Jesu nicht für das Reich
Gottes engagiert, versagt. Wenn man das
Herr-Sklave-Verhältnis in der antiken Gesellschaft bedenkt,
erscheint der Lohn als Lohn von anderer Art, als Gnadenlohn. Der
Herr ist ihn zu zahlen nicht verpflichtet, sondern gewährt
großzügige Teilhabe am Eigenen. Aufgerufen ist die Gemeinde in der
Zeit zwischen Ostern und Wiederkunft des Herrn. Es ist die Zeit
Jesu, insofern es die Zeit ist, in der die Gemeinde im Dienst Jesu –
und das heißt: im Dienst an den Menschen – steht. Die Auslegung im
Altertum und Mittelalter hat in den Sklaven vorzüglich die
Amtsträger der Kirche gesehen, Bischöfe, Priester und jene, welche
die Geistesgaben empfingen. Die Talente sind dann vorab die Gabe des
Wortes und der Lehre, um andere zu führen und anzuspornen. Luther
scheint die Talente auf den glauben und damit die Parabel auf alle
bezogen zu haben. Dem dritten Sklaven mangelt es an Glauben. leichtsinniges
Verspielen werden einander gegenübergestellt. Beides ist von
Bedeutung, wenngleich letzteres mit besonderer Schärfe
gekennzeichnet ist. Die Erwähnung von zwei sich bewährenden Sklaven
schöpft ihre Berechtigung aus der unterschiedlichen Gabe. Gott wirkt
in dieser Welt nicht mit Gleichmacherei, sondern berücksichtigt die
Möglichkeiten. Damit kommt keiner zu kurz. Entscheidend ist am Ende
die Annahme durch Gott, auf die jeder vertrauen kann, der sich ganz
auf das Wort Jesu einlässt und es in sein Leben umzusetzen bemüht
ist. Begünstigt die Parabel Leistungsdenken? In einem gewissen Sinne
schon, da vor allem der Sklave nicht besteht, der das Talent
begraben hat. Dabei darf das Verhältnis des Sklaven zum Herrn nicht
außer Acht gelassen werden: jeder lebt von der Gabe des Herrn. Was
er erzielt, kann nur in relativem Sinn als sein Erfolg gesehen
werden. Was von ihm erwartet wird, ist ein Beteiligt. Und
Interessiertsein. Wer sich als Jünger Jesu nicht für das Reich
Gottes engagiert, versagt. Wenn man das
Herr-Sklave-Verhältnis in der antiken Gesellschaft bedenkt,
erscheint der Lohn als Lohn von anderer Art, als Gnadenlohn. Der
Herr ist ihn zu zahlen nicht verpflichtet, sondern gewährt
großzügige Teilhabe am Eigenen. Aufgerufen ist die Gemeinde in der
Zeit zwischen Ostern und Wiederkunft des Herrn. Es ist die Zeit
Jesu, insofern es die Zeit ist, in der die Gemeinde im Dienst Jesu –
und das heißt: im Dienst an den Menschen – steht. Die Auslegung im
Altertum und Mittelalter hat in den Sklaven vorzüglich die
Amtsträger der Kirche gesehen, Bischöfe, Priester und jene, welche
die Geistesgaben empfingen. Die Talente sind dann vorab die Gabe des
Wortes und der Lehre, um andere zu führen und anzuspornen. Luther
scheint die Talente auf den glauben und damit die Parabel auf alle
bezogen zu haben. Dem dritten Sklaven mangelt es an Glauben. |
|
nach
oben |
(Text: kh, rp & dr , Fotos:gm) |
|
|
25.
September 2015
Claus
J. Raidl




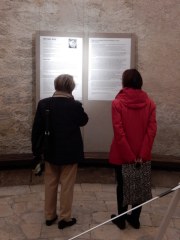
|
|
Vortrag von
Claus J. Raidl:
„Gewinnstreben und katholische Soziallehre“ |
|
 Dr.
Claus Raidl begann
seinen Vortrag mit der bemerkenswerten
Feststellung, dass die katholische Kirche sich nie fundiert mit dem
Phänomen „Wirtschaft“ auseinandergesetzt hat, weil ihre Zielgruppe
ursprünglich eher aus dem bäuerlichen Umfeld kam. Daher lag
wirtschaftliches Denken und damit Gewinnstreben („Gewinn ist der
Motor der Wirtschaft“) außerhalb des Gesichts- und
Beschäftigungsfeldes (wohl auch, um nicht in Konflikt mit den
Mächtigen zu geraten). Erst sehr spät, nämlich 1891, veröffentlichte
Papst Leo XIII die erste Sozialenzyklika „Rerum novarum“, die stark
im Zeitgeist verhaftet Eigentum als mehr oder minder sakrosankt
ansah und das Streikrecht, wie es von der damals aufkommenden
Arbeiterbewegung eingefordert wurde, völlig ablehnte. Selbst in der
zweiten Sozialenzyklika „Quadragesimo anno“ 1931 von Pius XI ist
noch immer die Unantastbarkeit des Eigentums oberste Prämisse. Dr.
Claus Raidl begann
seinen Vortrag mit der bemerkenswerten
Feststellung, dass die katholische Kirche sich nie fundiert mit dem
Phänomen „Wirtschaft“ auseinandergesetzt hat, weil ihre Zielgruppe
ursprünglich eher aus dem bäuerlichen Umfeld kam. Daher lag
wirtschaftliches Denken und damit Gewinnstreben („Gewinn ist der
Motor der Wirtschaft“) außerhalb des Gesichts- und
Beschäftigungsfeldes (wohl auch, um nicht in Konflikt mit den
Mächtigen zu geraten). Erst sehr spät, nämlich 1891, veröffentlichte
Papst Leo XIII die erste Sozialenzyklika „Rerum novarum“, die stark
im Zeitgeist verhaftet Eigentum als mehr oder minder sakrosankt
ansah und das Streikrecht, wie es von der damals aufkommenden
Arbeiterbewegung eingefordert wurde, völlig ablehnte. Selbst in der
zweiten Sozialenzyklika „Quadragesimo anno“ 1931 von Pius XI ist
noch immer die Unantastbarkeit des Eigentums oberste Prämisse.
 Dies
zeigt ein deutliches Nachhinken des kirchlichen Denkens mit der
Realität im wirtschaftlichen Zusammenhang und das ist eigentlich bis
heute zu beobachten. Eine Vordenkerrolle wurde bisher nie
eingenommen (übrigens auch nicht in Umweltfragen). Die im
Zusammenhang mit dem II. Vatikanischen Konzil unter Johannes XXIII
herausgekommene Enzyklika „Mater et magistra“ und selbst die 2009
nach einigen Neufassungen erschienene Sozialenzyklika „Caritas in
veritate“ von Benedikt XVI ist immer nur als Reaktion auf
wirtschaftliche (Fehl-) Entwicklungen zu verstehen. Raidl erklärte,
dass alle Veröffentlichungen der katholischen Kirche niemals als
„Bedienungsanleitung“ für richtiges sozialgerechtes wirtschaftliches
Handeln zu verstehen seien. Soziales Handeln kommt vielmehr aus
einer individuellen Ethik heraus, also einer Werteabwägung, die sich
von persönlicher Gewissensbildung ableitet. So hat er für sich
selbst z.B. die Entscheidung getroffen, dass es besser ist
unwirtschaftliche Betriebsteile zu schließen, um das restliche
Unternehmen gewinnbringend weiterführen zu können, als Arbeitsplätze
kurzfristig zu erhalten, damit aber den Bestand des gesamten
Unternehmens zu gefährden. Weiters versuchte er die Härte des
Arbeitsplatzverlustes insoweit abzufedern, indem Ausgleichszahlungen
erfolgten, die über dem rechtlich geforderten Ausmaß lagen. Dies
zeigt ein deutliches Nachhinken des kirchlichen Denkens mit der
Realität im wirtschaftlichen Zusammenhang und das ist eigentlich bis
heute zu beobachten. Eine Vordenkerrolle wurde bisher nie
eingenommen (übrigens auch nicht in Umweltfragen). Die im
Zusammenhang mit dem II. Vatikanischen Konzil unter Johannes XXIII
herausgekommene Enzyklika „Mater et magistra“ und selbst die 2009
nach einigen Neufassungen erschienene Sozialenzyklika „Caritas in
veritate“ von Benedikt XVI ist immer nur als Reaktion auf
wirtschaftliche (Fehl-) Entwicklungen zu verstehen. Raidl erklärte,
dass alle Veröffentlichungen der katholischen Kirche niemals als
„Bedienungsanleitung“ für richtiges sozialgerechtes wirtschaftliches
Handeln zu verstehen seien. Soziales Handeln kommt vielmehr aus
einer individuellen Ethik heraus, also einer Werteabwägung, die sich
von persönlicher Gewissensbildung ableitet. So hat er für sich
selbst z.B. die Entscheidung getroffen, dass es besser ist
unwirtschaftliche Betriebsteile zu schließen, um das restliche
Unternehmen gewinnbringend weiterführen zu können, als Arbeitsplätze
kurzfristig zu erhalten, damit aber den Bestand des gesamten
Unternehmens zu gefährden. Weiters versuchte er die Härte des
Arbeitsplatzverlustes insoweit abzufedern, indem Ausgleichszahlungen
erfolgten, die über dem rechtlich geforderten Ausmaß lagen.
 Dies
gelingt nur, wenn man sich selbst entsprechend in die Lage der
Arbeitnehmer hineinversetzen kann. Eine Politik der maximalen
Arbeitsplatzerhaltung, wie es in der Verstaatlichten Industrie v.a.
unter Kreisky im Vordergrund stand, ist jedenfalls langfristig zum
Scheitern verurteilt. Auch das reine Gewinnstreben aus
Spekulationen, die aus wachsender Gier entsteht, ist abzulehnen und
auch langfristig nicht erfolgreich. Raidl sprach sehr offen über die
in seinem Berufsleben extrem gestiegenen Managergehälter und vor
allem Bonuszahlungen und Stock-options-Programme, die er persönlich
ablehnt, weil auch sie die Gier fördern und nur zu kurzfristig
erfolgreichem Handeln verleiten. Motivation dazu ist nämlich die
persönliche Bereicherung und nicht die nachhaltige, stabile
Entwicklung eines Unternehmens und damit Erhalt der Arbeitsplätze.
In der nachfolgenden Diskussion wurden auch aktuelle
wirtschaftliche Probleme wie VW-Skandal etc. zur Sprache gebracht
und die Frage nach der Möglichkeiten der individuellen
Gewissensbildung gestellt. Dies
gelingt nur, wenn man sich selbst entsprechend in die Lage der
Arbeitnehmer hineinversetzen kann. Eine Politik der maximalen
Arbeitsplatzerhaltung, wie es in der Verstaatlichten Industrie v.a.
unter Kreisky im Vordergrund stand, ist jedenfalls langfristig zum
Scheitern verurteilt. Auch das reine Gewinnstreben aus
Spekulationen, die aus wachsender Gier entsteht, ist abzulehnen und
auch langfristig nicht erfolgreich. Raidl sprach sehr offen über die
in seinem Berufsleben extrem gestiegenen Managergehälter und vor
allem Bonuszahlungen und Stock-options-Programme, die er persönlich
ablehnt, weil auch sie die Gier fördern und nur zu kurzfristig
erfolgreichem Handeln verleiten. Motivation dazu ist nämlich die
persönliche Bereicherung und nicht die nachhaltige, stabile
Entwicklung eines Unternehmens und damit Erhalt der Arbeitsplätze.
In der nachfolgenden Diskussion wurden auch aktuelle
wirtschaftliche Probleme wie VW-Skandal etc. zur Sprache gebracht
und die Frage nach der Möglichkeiten der individuellen
Gewissensbildung gestellt. |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
nach
oben |
(Text: dr , Fotos:gm) |
|
|
26.
September 2015
Altabt Gregor
Henckel-Donnersmarck


vor dem Vortrag im Karner


beim Vortrag:

folgende Ratschläge finden sich auf am
vorderen Bucheinband:
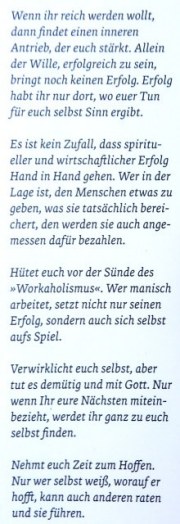
|
|
Gregor Henckel-Donnersmarck:
„Die Kirche und das liebe Geld“ |
|
 |
 |
|
Altabt Gregor
Henckel-Donnersmarck begann seinen sehr persönlich gehaltenen
Vortrag mit der Feststellung, dass er schon in seinem
„vorklösterlichen“ Leben aus für ihn unerklärlichen Gründen in
Gesprächen mit Freunden immer bei religiösen Themen landete, wobei
er zu einem erklärten Verteidiger v.a. des Papstamtes wurde. Gerade
Paul VI. mit seiner introvertierten, wissenschaftlichen Art forderte
immer wieder Kritik heraus, die Henckel-Donnermarck „engagiert aber
nicht sehr fundiert“ abzuwehren suchte. Dies gilt auch noch heute
bei Papst Franziskus I., der aus Argentinien mit gänzlich
unterschiedlichen Bevölkerungsstrukturen kommend einen ganz anderen
Zugang zu wirtschaftlichen Fragen hat als der studierte
Diplomkaufmann Henckel-Donnersmarck („Right or wrong, he´s the pope!“)
Damit sind vielleicht schon einige Beweggründe für den doch
überraschend wirkenden Wechsel des damals 33 jährigen aus der
Wirtschaft zur Theologie begründet. Gerade die strikten Strukturen
und Hierarchien klösterlichen Lebens kamen ihm offensichtlich
entgegen und führten auch dazu, dass er diesen Schritt noch nie
bereut hat. |
|
 |
 |
|
Zum Thema kommend erklärte
Henckel-Donnersmarck zuerst das Gleichnis vom Kamel und dem
Nadelöhr, das für uns eigentlich eine total aussichtslose Situation
schildert: allerdings ist mit dem Nadelöhr nicht eine Nähnadel
gemeint, sondern die kleine Gehtür für Fußgänger in einem großen (Stadt)Tor,
wie z.B. in Jerusalem. Um hier ein Kamel durchzutreiben, muss man es
komplett abladen, auf die Knie zwingen und dann mit viel Gewalt und
Geschrei durchzerren. Aufwändig, aber nicht ganz unmöglich! Der
Nachsatz des Gleichnisses ist ja auch „Bei Gott ist nichts
unmöglich!“, - ein sehr tröstlicher Gedanke, der Hoffnung zulässt.
Auch die Aussage „Gewinn ist nicht verwerflich!“ lässt aufhorchen,
ist man doch von der Bibel her eher gewohnt, dem Reichtum
abzuschwören um in das Himmelreich zu kommen. Relativiert wird diese
Aussage aber durch den Zusatz, „es kommt aber darauf an, wie man mit
diesem Gewinn umgeht und das Geld verwendet“. Das anschauliche Wort
„Vermögenskultur“ sagt dazu einiges aus. Als Beispiel wurde der
Katholik Bill Gates zitiert, der mit seiner Stiftung viele weltweite
Förderprojekte unterstützt. Auch der Erbanspruch wurde angesprochen,
der in der Bibel interessanterweise keine Unterstützung findet, -
eine Tatsache, die dazu einlädt in unserer heutigen „Zeit der Erben“
darüber nachzudenken. Auch der oft und viel strapazierte Begriff vom
„Reichtum der Kirche“ kam zur Sprache, - dass man mit dem Erlös aus
dem Verkauf der Kirchenschätze doch den Armen helfen könnte: dieses
Vermögen der Kirche sieht Henckel-Donnersmarck als Teil der
Kult-Kultur und ein Verkauf würde auch nur kurzfristig und einmalig
helfen, ganz abgesehen von der Unbewertbarkeit vieler Kunstschätze.
Er sieht vielmehr das Vermögen der Kirche in der anhaltenden
Spendenfreudigkeit ihrer Mitglieder. Diese Gelder müssen mit großer
Umsicht und mit Respekt verwaltet werden, durchaus auch mit
wirtschaftlichem Denken. Überhaupt nimmt Henckel-Donnersmarck
anscheinend innerhalb der Kirche eine Sonderstellung ein, da er mit
dem Ordensgelübde keineswegs seine wirtschaftliche Ausbildung und
Denkweise abgelegt hat, sondern versucht, sie im Einklang mit seinem
Glauben zu leben. Dies ist auch die Forderung an alle anderen
Christen und kann nur durch individuelle Gewissensbildung erfolgen.
Keineswegs stellen Enzykliken oder andere kirchliche Schriften eine
Schritt für Schritt-Anleitung zum richtigen Umgang mit Geld oder
Reichtum dar. |
|
 |
 |
|
Bei der lebhaften Diskussion wurden
aktuelle Fragen, wie die schlechte Medienpräsenz der katholischen
Kirche in der Flüchtlingsfrage angesprochen. Henckel-Donnersmarck
meinte, dass hier auch der journalistische Gegenwind unserer
relativistisch orientierten Zeit zu spüren sei. Auch die oft zu
allgemein erfolgende Verteufelung der Begriffe „Kapitalismus“ und
„Spekulation“ aus kirchlichen Kreisen wurde aufgezeigt und
besprochen. |
|
Buchtip: Gregor
Henckel-Donnersmark:
Reich werden auf die gute Art
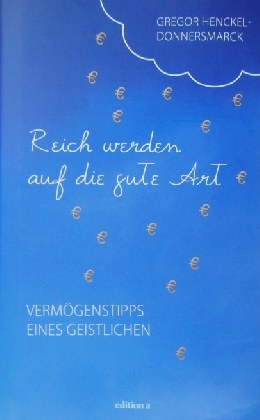
 |
 |
 |
 |
|
nach
oben |
(Text: dr, Fotos:gm) |
|
|
27. September
2015 „Die Glücksritter - The Trading Place“:
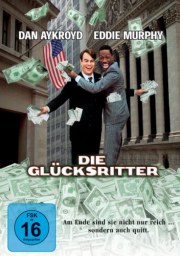
mit
Wolfgang Ritzberger



|
|
Filmabend:
„Die Glücksritter - The Trading Place“
deutscher Trailer hier
-
Eröffnungsszene hier
Text folgt in Kürze |
 "The
trading place", in der deutschen Fassung "Die Glücksritter" (die wie
so oft, nicht ganz den Punkt trifft) ist ein Film von John Landis
aus dem Jahr 1983. Der englische Titel ist übrigens ein Wortspiel,
einerseits bedeutet es "Marktplatz" anderseits aber auch
"Platzwechsel", im Sinne von "die Plätze tauschen", was mit den
Protagonisten des Filmes ja auch geschieht. Dan Akroyd und Eddie
Murphy spielen die Hauptrollen, Jamie Lee Curtis eine Nebenrolle,
dafür wurde sie auch mit einem britischen Schauspielerpreis geehrt
und für den Oscar für "the best supporting Act" nominiert. "The
trading place", in der deutschen Fassung "Die Glücksritter" (die wie
so oft, nicht ganz den Punkt trifft) ist ein Film von John Landis
aus dem Jahr 1983. Der englische Titel ist übrigens ein Wortspiel,
einerseits bedeutet es "Marktplatz" anderseits aber auch
"Platzwechsel", im Sinne von "die Plätze tauschen", was mit den
Protagonisten des Filmes ja auch geschieht. Dan Akroyd und Eddie
Murphy spielen die Hauptrollen, Jamie Lee Curtis eine Nebenrolle,
dafür wurde sie auch mit einem britischen Schauspielerpreis geehrt
und für den Oscar für "the best supporting Act" nominiert. |
 John
Landis ist als Regisseur vor allem seiner Komödien wegen bekannt:
"Die Bluesbrothers" und "American Werewolf" sind Kultfilme; und weil
er mit Michael Jackson als Schöpfer moderner Musikvideos gilt, das
Musikvideo zu "Thriller" ist unter seiner Regie zu einem mehr als 20
Minuten langem Kurzfilm geworden, der dieses Genre neu definierte. John
Landis ist als Regisseur vor allem seiner Komödien wegen bekannt:
"Die Bluesbrothers" und "American Werewolf" sind Kultfilme; und weil
er mit Michael Jackson als Schöpfer moderner Musikvideos gilt, das
Musikvideo zu "Thriller" ist unter seiner Regie zu einem mehr als 20
Minuten langem Kurzfilm geworden, der dieses Genre neu definierte.
Dan Akroyd und Eddie Murphy kennen einander von der "Saturday Night
Live", einer legendären TV Comedy Show, aus deren Team auch John
Belushi, Bill Murray, Chevy Chase u.a. kommen. Jamie Lee Curtis ist
die Tochter von Tony Curtis und Janeth Leigh, die bis zu "The
Trading Place" eher als Scream Queen aus Horrofilmen bekannt war,
dieser Film war für sie der Durchbruch ins humoristische Fach, wo
sie mit "Ein Fisch namens Wanda" sich endgültig etablieren konnte. |
 Die
Geschichte basiert auf mehreren Literaturvorlagen, so unter anderem
auf "Der Prinz und der Bettelknabe" sowie "The Million Pound Bank
Note" von Mark Twain. Zwei alte Warentermin-Banker tauschen die
Leben ihres Geschäftsführers und eines Bettlers, um zu sehen, ob nur
die Umstände aus einem Menschen machen was er ist. Während der
ehemalige Geschäftsführer Lois Wintorp (Dan Akroyd) mittellos auf
der Strasse landet, machen sie den Bettler Billy Ray (Eddie Murphy)
zu seinem Nachfolger. Allerdings rächen sich die beiden und zu guter
letzt werden noch einmal die Plätze getauscht. Die
Geschichte basiert auf mehreren Literaturvorlagen, so unter anderem
auf "Der Prinz und der Bettelknabe" sowie "The Million Pound Bank
Note" von Mark Twain. Zwei alte Warentermin-Banker tauschen die
Leben ihres Geschäftsführers und eines Bettlers, um zu sehen, ob nur
die Umstände aus einem Menschen machen was er ist. Während der
ehemalige Geschäftsführer Lois Wintorp (Dan Akroyd) mittellos auf
der Strasse landet, machen sie den Bettler Billy Ray (Eddie Murphy)
zu seinem Nachfolger. Allerdings rächen sich die beiden und zu guter
letzt werden noch einmal die Plätze getauscht. |
 Wiewohl
eine Komödie spielt sie vor der "letzten Bastion des Kapitalismus"
(Dialog aus dem Drehbuch), der Warenterminbörse und nimmt genau
diese Welt aufs Korn. Hier wird brutal und ohne jede Hemmung
spekuliert, die Preise, die hier festgesetzt werden und oft auch für
den Weltmarkt gelten, haben oft nichts mit der Realität zu tun. Die
indischen Reisbauern etwa können sich den eigenen Reis nicht
leisten, weil auf den Warenterminbörsen in den USA der
Weltmarktpreis festgelegt wird. Hinter der Komödie verbirgt sich
also ein durchaus ernstzunehmender Kern, die "falschen" Freunde
Winthorps sind eine böse Satire auf die US-amerikanische Upper-Class
Gesellschaft, mit ihren exclusiven Tennis- und Herrenclubs. Hinter
dem Humor, etwa auf der Polizeistation, der sich aus der
Konfrontation zweier Welten ergibt, steckt, wenn man sie sehen will,
auch Kritik. Wiewohl
eine Komödie spielt sie vor der "letzten Bastion des Kapitalismus"
(Dialog aus dem Drehbuch), der Warenterminbörse und nimmt genau
diese Welt aufs Korn. Hier wird brutal und ohne jede Hemmung
spekuliert, die Preise, die hier festgesetzt werden und oft auch für
den Weltmarkt gelten, haben oft nichts mit der Realität zu tun. Die
indischen Reisbauern etwa können sich den eigenen Reis nicht
leisten, weil auf den Warenterminbörsen in den USA der
Weltmarktpreis festgelegt wird. Hinter der Komödie verbirgt sich
also ein durchaus ernstzunehmender Kern, die "falschen" Freunde
Winthorps sind eine böse Satire auf die US-amerikanische Upper-Class
Gesellschaft, mit ihren exclusiven Tennis- und Herrenclubs. Hinter
dem Humor, etwa auf der Polizeistation, der sich aus der
Konfrontation zweier Welten ergibt, steckt, wenn man sie sehen will,
auch Kritik. |
|
nach
oben |
(Text: wr, Fotos:gm) |
|
|
|
| Die Inhalte dieser Webseite sind
ausschließlich für private Nutzung erlaubt. Inhalte, das heisst Text oder
Bilder, dürfen nicht zum Teil oder als Ganzes ohne Erlaubnis
verwendet werden, da diese urheberrechtlich geschützt sind.
|
|
Impressum - Für mehr Informationen schreiben sie
bitte an
kunst-im-karner@othmar.at
|

















 Es
ist mir eine Freude, einige Worte zur der Installation „balanceAKT“
von Michael Kos sagen zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung!
Es
ist mir eine Freude, einige Worte zur der Installation „balanceAKT“
von Michael Kos sagen zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung! 
 Der
Corpus Christi und das Kreuz sind Symbole, die wie kam andere in
unserer Kultur und Geschichte verankert sind. Das Kreuz ist das
Hauptsinnzeichen des Christentums. „Man komme“, so Kos, „als Künstler
an diesem Zeichen nicht vorbei, man müsse sich mit ihm beschäftigen,
sich auch daran reiben.“ Schon in seinen sogenannten
„Körperkreuzungen“ von 2012 splittert der Künstler das Kreuz als auch
den Corpus auf und setzt die Teile ähnlich einer Metamorphose in
überraschenden Konstellationen neu zusammen. Kos lässt dadurch eine
neue, originäre Körperlichkeit entstehen und hinterfragt damit – wie
auch bei der Arbeit im Karner – den tradierten skulpturalen Charakter
des Kreuzes. Der Künstler nimmt hier das Achsenkreuz weg und fügt eine
andere Achse, eine Gleichgewichtsachse hinzu. Durch diesen Eingriff
verändert sich die Skulptur in seinem Sinngehalt. Einerseits sehen wir
noch den gekreuzigten Christus, anderseits sehen wir aber auch etwas
anderes, Neues...
Der
Corpus Christi und das Kreuz sind Symbole, die wie kam andere in
unserer Kultur und Geschichte verankert sind. Das Kreuz ist das
Hauptsinnzeichen des Christentums. „Man komme“, so Kos, „als Künstler
an diesem Zeichen nicht vorbei, man müsse sich mit ihm beschäftigen,
sich auch daran reiben.“ Schon in seinen sogenannten
„Körperkreuzungen“ von 2012 splittert der Künstler das Kreuz als auch
den Corpus auf und setzt die Teile ähnlich einer Metamorphose in
überraschenden Konstellationen neu zusammen. Kos lässt dadurch eine
neue, originäre Körperlichkeit entstehen und hinterfragt damit – wie
auch bei der Arbeit im Karner – den tradierten skulpturalen Charakter
des Kreuzes. Der Künstler nimmt hier das Achsenkreuz weg und fügt eine
andere Achse, eine Gleichgewichtsachse hinzu. Durch diesen Eingriff
verändert sich die Skulptur in seinem Sinngehalt. Einerseits sehen wir
noch den gekreuzigten Christus, anderseits sehen wir aber auch etwas
anderes, Neues...  Zurück
zur Christusfigur. Durch die Transformation fordert Kos uns auf,
genauer hinsehen: Gerade durch die Veränderung des Kreuzes, werden wir
uns dessen ursprünglichen Aussehens wieder stärker bewusst. Wie zeigen
wir Menschen die christliche Figur, in welcher figurativen Form, mit
welcher Körpersprache? Wie wird der Körper, der Akt dafür benutzt?
Oder, noch tiefer gehend: Wie hat sich die Darstellung des Kreuzes im
Laufe der Zeit verändert: vom Christus als König in der Romanik über
den leidenden, Empathie hervorrufenden Christus in der Gotik bis zu
den vielfältigen Christusdarstellungen in der heutigen Zeit?
Zurück
zur Christusfigur. Durch die Transformation fordert Kos uns auf,
genauer hinsehen: Gerade durch die Veränderung des Kreuzes, werden wir
uns dessen ursprünglichen Aussehens wieder stärker bewusst. Wie zeigen
wir Menschen die christliche Figur, in welcher figurativen Form, mit
welcher Körpersprache? Wie wird der Körper, der Akt dafür benutzt?
Oder, noch tiefer gehend: Wie hat sich die Darstellung des Kreuzes im
Laufe der Zeit verändert: vom Christus als König in der Romanik über
den leidenden, Empathie hervorrufenden Christus in der Gotik bis zu
den vielfältigen Christusdarstellungen in der heutigen Zeit?  Auch
der Tabernakel wird transformiert: Anstelle eines Tabernakels sehen
wird einen Tresor, die darin aufbewahrten Hostien erinnern an
Geldmünzen. Sie sind mit der Zahl 1 und dem Satz „Geld ist die soziale
Transsubstanz“ bedruckt. Das Geld als neue Religion?
Auch
der Tabernakel wird transformiert: Anstelle eines Tabernakels sehen
wird einen Tresor, die darin aufbewahrten Hostien erinnern an
Geldmünzen. Sie sind mit der Zahl 1 und dem Satz „Geld ist die soziale
Transsubstanz“ bedruckt. Das Geld als neue Religion?  Damit
verwebt Kos in seiner Installation religiöse Symbolik mit
gesellschaftssozialen Fragen. Der balancierende Christus steht für das
Gleichgewicht in unserer Gesellschaft – oder vielmehr, er warnt vor
dem Verlust dieses Gleichgewichtes, vor der Ungleichheit der
Verteilung der Güter in unserer Welt, in der wenigen viel gehört und
vielen wenig. Dieser Christus ist aber in noch so vielerlei Hinsicht
interpretierbar: wir können darin auch schwankende Werte sehen, eine
Zeit des Wandels, in der viele Sicherheiten brüchig werden...
Damit
verwebt Kos in seiner Installation religiöse Symbolik mit
gesellschaftssozialen Fragen. Der balancierende Christus steht für das
Gleichgewicht in unserer Gesellschaft – oder vielmehr, er warnt vor
dem Verlust dieses Gleichgewichtes, vor der Ungleichheit der
Verteilung der Güter in unserer Welt, in der wenigen viel gehört und
vielen wenig. Dieser Christus ist aber in noch so vielerlei Hinsicht
interpretierbar: wir können darin auch schwankende Werte sehen, eine
Zeit des Wandels, in der viele Sicherheiten brüchig werden... Die
Installation wirkt sehr fragil, es scheint sehr anstrengend zu sein,
das Gleichgewicht zu halten. Zusätzlich ist im Ausstellungsraum ein
leichter Wind zu spüren, verursacht von einer Windmaschine. Kos war es
wichtig, neben statischen Objekten auch ein dynamisches, immaterielles
Element zuzulassen – ein Element, das den Corpus in leichte, kaum
sichtbare Schwingungen versetzt.
Die
Installation wirkt sehr fragil, es scheint sehr anstrengend zu sein,
das Gleichgewicht zu halten. Zusätzlich ist im Ausstellungsraum ein
leichter Wind zu spüren, verursacht von einer Windmaschine. Kos war es
wichtig, neben statischen Objekten auch ein dynamisches, immaterielles
Element zuzulassen – ein Element, das den Corpus in leichte, kaum
sichtbare Schwingungen versetzt.  „Ein Wind kommt auf“: ein Zeichen, das wir aus der Bibel her kennen.
So wird etwa das Kommen des Heiligen Geistes gerne als Wind und Atem
beschrieben. In der Apostelgeschichte, Kapitel 2,2/3 heißt es (das
Pfingstwunder): „Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie
von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie
saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. ...“ In
der Ausstellung bringt der Wind dagegen Unruhe in das Geschehen.
„Ein Wind kommt auf“: ein Zeichen, das wir aus der Bibel her kennen.
So wird etwa das Kommen des Heiligen Geistes gerne als Wind und Atem
beschrieben. In der Apostelgeschichte, Kapitel 2,2/3 heißt es (das
Pfingstwunder): „Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie
von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie
saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. ...“ In
der Ausstellung bringt der Wind dagegen Unruhe in das Geschehen.












 Verleih
und 50%, also die Hälfte der Einnahmen, das Lichtspieltheater). Der
Grund dafür ist wahrscheinlich in der Tatsache zu suchen, dass den
US-Amerikanern das Thema zu heikel und außerdem unangenehm ist. Die
USA ruhen seit ihrer Gründung nicht auf ideologischen Ideen sondern
auf den Säulen des Dollars (die Gründer der USA
konnten etliche Bundesstaaten nur zum Mitmachen überzeugen, weil sie
deren Schulden aus dem Unabhängigkeitskrieg übernahmen und
gleichzeitig die Notenpresse anwarfen), auch Hollywood gehört zum Teil
Investmentfonds, Holdings und Banken, da kommt die Beschäftigung mit
einem solchen Thema nicht so gut an. Trotzdem wurde der Film für den
Oscar für das beste Drehbuch nominiert und in Berlin für den Goldenen
Löwen.
Verleih
und 50%, also die Hälfte der Einnahmen, das Lichtspieltheater). Der
Grund dafür ist wahrscheinlich in der Tatsache zu suchen, dass den
US-Amerikanern das Thema zu heikel und außerdem unangenehm ist. Die
USA ruhen seit ihrer Gründung nicht auf ideologischen Ideen sondern
auf den Säulen des Dollars (die Gründer der USA
konnten etliche Bundesstaaten nur zum Mitmachen überzeugen, weil sie
deren Schulden aus dem Unabhängigkeitskrieg übernahmen und
gleichzeitig die Notenpresse anwarfen), auch Hollywood gehört zum Teil
Investmentfonds, Holdings und Banken, da kommt die Beschäftigung mit
einem solchen Thema nicht so gut an. Trotzdem wurde der Film für den
Oscar für das beste Drehbuch nominiert und in Berlin für den Goldenen
Löwen.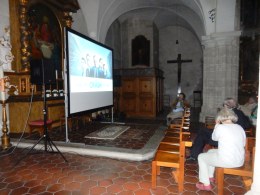



















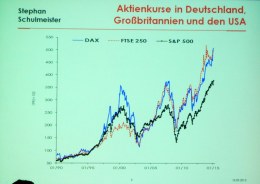
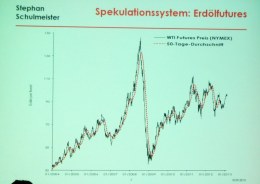
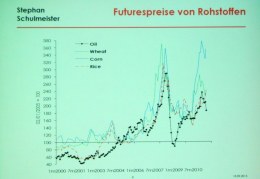

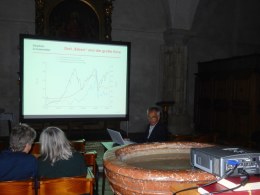







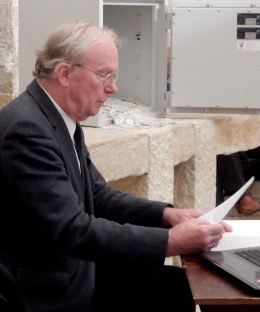

 Die
Geschichte, die Jesus hier erzählt ist als Gegenstück zur Erzählung
vom dummen Reichen zu erkennen. Die von der Hauptfigur geplanten
Handlungen führen im Fall des reichen Kornbauern dazu, dass Gott ihn
als „Narr“ bezeichnet, während die Handlungen des unehrlichen
Verwalters diesem das Lob eintragen, „Klug“ gehandelt zu haben.
Diese Antithese wird dadurch profiliert, dass der dumme Bauer seine
Situation falsch einschätzt, während der Verwalter aus der Lage, in
der er sich befindet, die richtigen Konsequenzen zieht und alles
tut, damit der „bei Gott reich ist“. Die Erzählung endet offen:
Weder wird erzählt, wie der reiche Mann auf die Aktion seines
Verwalters reagiert, noch, ob sie erfolgreich war und er nach seiner
Entlassung von den Schuldnern seines Herrn auch tatsächlich
aufgenommen wird. Innerhalb des zeitlichen Ablaufs der Erzählung
werden die Hörer genau in die Situation gestellt, in der der
entlassene Verwalter den inneren Monolog spricht und sich fragt, was
er tun soll.
Die
Geschichte, die Jesus hier erzählt ist als Gegenstück zur Erzählung
vom dummen Reichen zu erkennen. Die von der Hauptfigur geplanten
Handlungen führen im Fall des reichen Kornbauern dazu, dass Gott ihn
als „Narr“ bezeichnet, während die Handlungen des unehrlichen
Verwalters diesem das Lob eintragen, „Klug“ gehandelt zu haben.
Diese Antithese wird dadurch profiliert, dass der dumme Bauer seine
Situation falsch einschätzt, während der Verwalter aus der Lage, in
der er sich befindet, die richtigen Konsequenzen zieht und alles
tut, damit der „bei Gott reich ist“. Die Erzählung endet offen:
Weder wird erzählt, wie der reiche Mann auf die Aktion seines
Verwalters reagiert, noch, ob sie erfolgreich war und er nach seiner
Entlassung von den Schuldnern seines Herrn auch tatsächlich
aufgenommen wird. Innerhalb des zeitlichen Ablaufs der Erzählung
werden die Hörer genau in die Situation gestellt, in der der
entlassene Verwalter den inneren Monolog spricht und sich fragt, was
er tun soll.