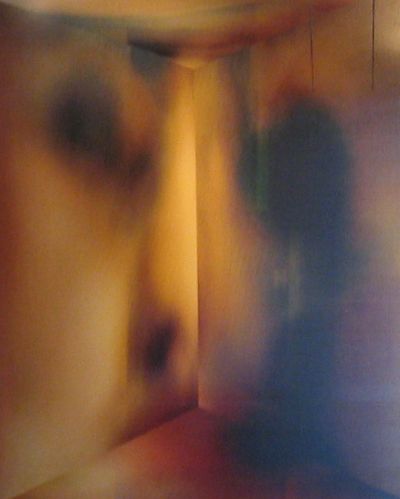|

Bilder im Karner:

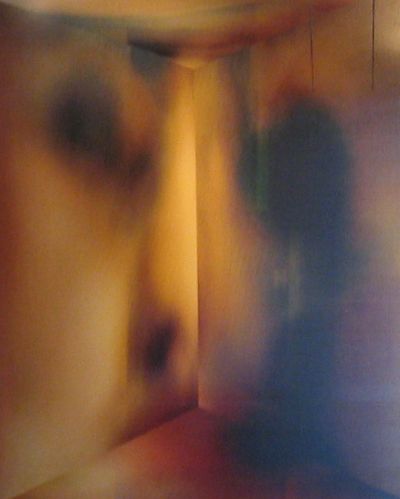


Dreieck im Karner:

|
Es hat durchaus einen eigenen Charme, sich an diesem Ort
mit Schöpfung zu beschäftigen. In einem Gebeinhaus, in einer
Aufbewahrungsstätte für Knochen. Man könnte meinen, dass sich hier
viel eher der zweite Begriff aus dem Titel der Veranstaltung, die
Evolution, aufdrängt. Eine durchaus schlüssige Folgerung: Die
Evolution sei bei dieser Ansammlung aus Gebeinen an ihr Ziel gelangt, es
sei vollbracht. Jedoch die Schöpfung kontert, erinnert geschickt an die
Vision des Ezechiel. Der Prophet berichtet, der Herr habe ihm eine Ebene
voller ausgetrockneter Gebeine gezeigt und zu ihm gesprochen: Ich selbst
bringe Geist in euch, dann werdet ihr lebendig. Ich spanne Sehnen über
euch und umgebe euch mit Fleisch; ich überziehe euch mit Haut und
bringe Geist in euch, dann werdet ihr lebendig. (Ez 37,5f) Wie es sich
für eine gute Geschichte gehört, folgt das Happy End auf den Fuß, es
ist also durchaus noch nicht vollbracht.
Und oder doch oder
Schöpfung und Evolution oder doch: Schöpfung oder Evolution, so lautet
hier die Frage. Ausgetrocknete Gebeine oder lebendiges Fleisch – so
die Gegenüberstellung nach der Logik des Ezechiel-Buches. Der schroffe
Gegensatz löst sich durch eine neue oder eine anhaltende Schöpfung in
ein fröhliches Und aus Gebeinen und Fleisch und Geist auf. Das wäre
die visionäre Logik. In der formalen Logik, die als mathematisches
System funktioniert, bleibt dieser Ausweg verwehrt. Seit alters her
gilt: Tertium non datur, ein Drittes gibt es im kristallklaren
Entweder-Oder nicht. Die Einfriedung von Nichtgleichem in einen
gemeinsamen Bezirk erlaubt ausschließlich das Und, das Oder setzt
solches schroff in zwei je eigene Bereiche und lässt sie wie
Bocciakugeln aufeinander prallen. Nun stehen wir hier nicht vor
Gebeinen, sondern vor Kunstwerken, vor Schöpfungen und/oder Evolutionen
von Johannes Deutsch. Seine Arbeitsweise hat viel mit dem Spiel zwischen
dem Und und dem Oder zwischen Schöpfung und Evolution zu tun. Johannes
Deutsch ist ein Computerkünstler, zumindest was den Produktionsprozess
der hier vorgestellten Arbeiten betrifft. Er hat sich aber nicht den
vorgegebenen Werkzeugen der Zeichenprogramme unterworfen, nein, er hat
sich die Maschine dienstbar gemacht und benützt sie gemäß seiner
Notwendigkeiten. Die Orte seiner Bilder sind Überwelten, surreale
Traumräume. Die Gesichte, die auf Schatten zurückgehen, die irgendein
Gegenstand an der nächtlichen Wand im Zimmer eines Schlaftrunkenen
entstehen lässt, diese Gesichte sind ihm wichtiger als die
tatsächlichen Gesichter, die als Fotografie Grundlage der Arbeiten hier
sind.
Die Visionen des Johannes Deutsch mögen zwar ganz andere als jene des
Ezechiel sein, ein „Experte der Zukunft“ möchte er laut
Selbstaussage aber allemal werden und trifft sich darin mit den
Ansprüchen des Propheten. Die Entwicklung dieser Visionen mit dem
Werkzeug Computer lässt diese aus dem vollständig gegensätzlichen
System des binären Codes entstehen. In diesem System herrscht eindeutig
das Oder, jedem Pixel ist ein spezifischer Farbwert zugeordnet, und zwar
ausschließlich. Johannes Deutsch überführt aber das Ausschlussprinzip
in seine Welt des bestimmten Und, in seine Schöpfungen von Bildräumen.
Die Arbeiten von Johannes Deutsch stehen zumindest
hinsichtlich zweier Aspekte in der Tradition der Renaissance. Einmal
durch die Idee des „uomo universale“, der Kunst und Wissenschaft in
einer Person vereint. Aus heutiger Sicht zeigt sich, dass sowohl die
Kunst als auch die Wissenschaft eine künstliche Welt erzeugen, um mit
der tatsächlichen Welt besser umgehen zu können. Der Wissenschafter
versucht, sich selbst aus seinen Experimenten heraus zu halten, objektiv
zu sein – was eine Illusion ist. Der Künstler arbeitet von
vorneherein mit der Illusion – und ist damit völlig realistisch.
Ein künstlicher Raum
So belegt Johannes Deutsch zunächst seine Bildoberfläche mithilfe der
Zentralperspektive mit einem Raumwinkel, er suggeriert, dass sich die
ebene Leinwand oder Fotografie in die Tiefe erweitert. Überlagert wird
dieser künstliche Raum durch die Fotografie eines Gesichts. Und nun
setzen die Mehrfachumstülpungen ein, mit denen Johannes Deutsch seine
Traumwelt aufbaut. Das, was wir als sich von uns entfernenden Winkel
wahrnehmen, ist in der „wirklichen“ Welt die Ecke eines Holzhauses,
die uns dort im Raum entgegenragt: Es ereignet sich Umstülpung Nummer
Eins. Ähnliches geschieht mit dem Gesicht. Im Alltag ist ein Gesicht
ebenfalls eine räumliche Form, die potenziellen Betrachtern
entgegenragt, soll sie sich aber nun dem Winkel, dem fliehenden Raum,
anschmiegen, dann muss auch das Gesicht umgestülpt werden: Umstülpung
Nummer Zwei ist vollzogen.
Das gilt aber nur, wenn die Betrachter das Gesicht als ein Gegenüber,
als ein Fremdes annehmen. Sobald diese sich mit dem Gesicht
identifizieren wie mit einer Hauptakteurin in einem spannenden Film
etwa, geschieht die Umstülpung bereits vor dem Bild. Umstülpung Nummer
drei wäre die Anpassung des Gesichts der Betrachter an jenes auf den
Bildern. Alle, die diesen Schritt vollziehen, werden plötzlich zu
Winkelstehern, die in finstere Trichter blicken, wie Johannes Deutsch
seine Raumecken nennt. Dieses Identifizierungsspiel öffnet sich
zumindest in den dreidimensionalen Objekten zu einer Durchgangsstation.
Der Trichter erinnert dann mehr an einen Geburtskanal, die
Identifizierung an jene unumgänglichen Schritte, die zu unserer
Individuation, manchmal sogar zu unserer Selbstfindung führen; zu der
nicht zuletzt die Kunst entscheidende Anlässe bietet. Insofern ist
diese Präsentation hier eine Einladung an uns alle.
Kunst nicht vereinnahmen
Es kann hier niemals darum gehen, den Streit der theologischen
Schöpfungslehre mit der Evolutionstheorie der modernen
Naturwissenschaften auf dem Rücken eines Künstlers auszutragen. Hier
reicht es vollauf, wenn beide Wissenschaften sich an ihre selbst
gesteckten Rahmenbedingungen halten. Kein Theologe kann daher
sinnvollerweise die Schöpfungsberichte als naturwissenschaftliche
Darlegungen interpretieren; umgekehrt wird sich auch die
Naturwissenschaft nicht anmaßen, Antworten auf jene „letzten“
Fragen geben zu wollen, die sie vorher per definitionem aus ihrem System
ausgeschlossen hat. Wenn diese Voraussetzungen eingehalten werden,
können sich Vertreter beider Fächer als Menschen über diese
Streitfragen unterhalten. Dann ist es auch sinnvoll, sich mit einem
Meister des Und, wie Johannes Deutsch es ist, auseinanderzusetzen.
Unter dieser Vorgabe ist es auch erlaubt, meine Anregungen zu einem
genussvollen Umgang mit den Arbeiten von Johannes Deutsch mit einer
Aussage seines Namensvetters Johannes Chrysostomos parallel zu stellen.
Er meinte: „Ich will dich zu einer noch leichter verständlichen Kunst
führen, z. B. der Malerei, und auch da wird es dir schwindlig werden.
Kommt dir nicht alles, was der Maler tut, planlos vor? Was kann er mit
den Strichen, mit den Umrissen wollen? Wenn er aber die Farbe aufträgt,
dann erscheint dir die Kunst schön – wiewohl du auch so noch kein
genaues Verständnis gewinnst.“
|